| |
Die Inschriften des Bundeslandes Tirol
Politische Bezirke Imst, Landeck und Reutte
6. Die Inschriftenträger
An kaum einer anderen Stelle der Einleitung lässt sich anschaulicher zeigen, welche Bedeutung
der Aufarbeitung der westösterreichischen und insbesondere der Tiroler Epigraphik im Rahmen
der gesamtösterreichischen Inschriftenlandschaft zukommt. Schon ein erster Blick auf Tabelle 5
zeigt, dass die Verteilung der Inschriftengattungen im Tiroler Raum einen deutlichen Unterschied
zur ostösterreichischen Inschriftenlandschaft konstituiert. Stellen die Denkmäler des Totengedenkens
etwa im Politischen Bezirk Krems rund 37% der Katalognummern des entsprechenden DI-Bandes110,
in Wiener Neustadt gar nahezu die Hälfte111, so sind es hier im Tiroler Oberland
gerade einmal knapp über 18%, was nur wenig über dem Bestand an Glocken und dem an Inschriften
auf Objekten der kirchlichen Ausstattung (Altären, liturgischem Gerät etc.) liegt. Den
Löwenanteil der Katalognummern machen im Oberland charakteristischerweise Inschriften an
Gebäuden aus, also Wandmalereien wie Fassadendekorationen samt Beischriften oder inschriftlich
kommentierte Wandmalereiprogramme in Kirchen; sie machen rund 31% des Bestandes aus.
Kleinere Inschriftengruppen stellen die (allerdings nach Katalognummern und nicht nach Einzelinschriften
gezählten) Graffiti mit rund 10%, sowie Glasmalereien und Inschriften auf profanen
Einrichtungsgegenständen mit je 4,7%.
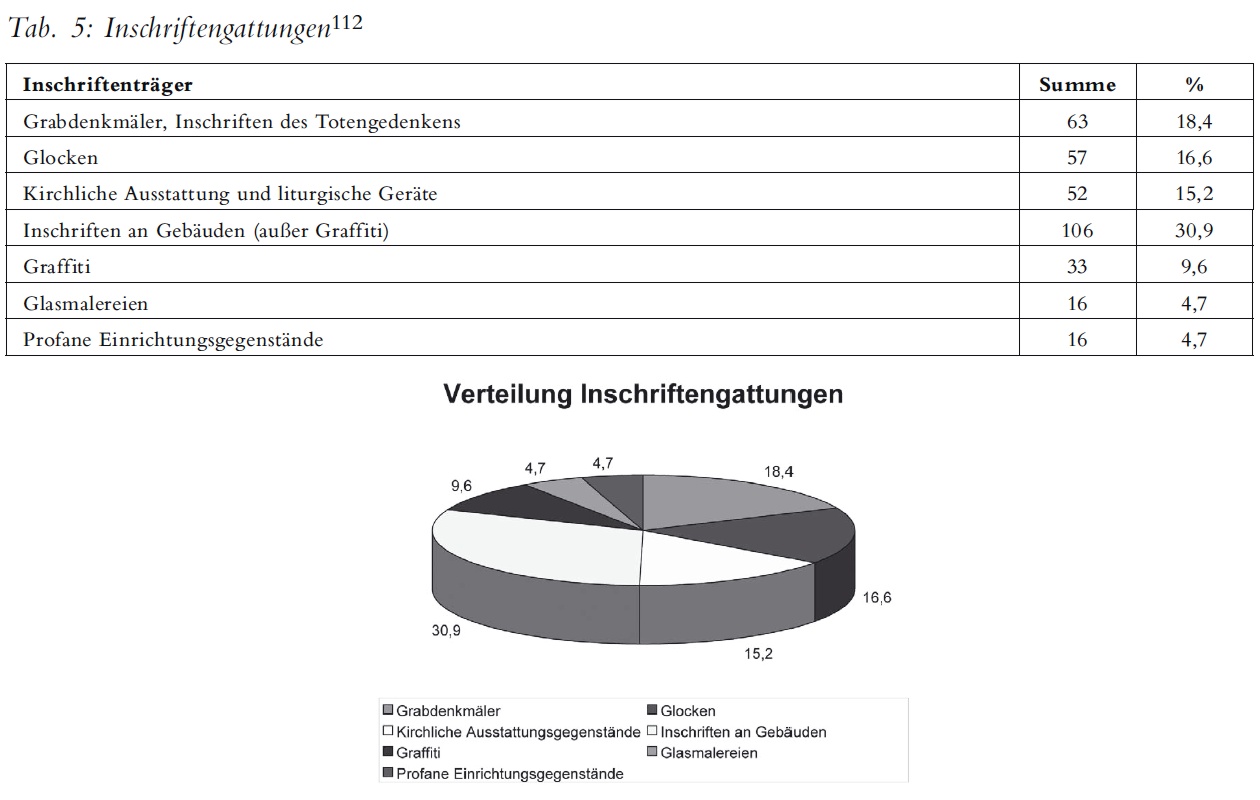
6.1. Grabdenkmäler und Inschriften des Totengedenkens
Die Grabdenkmäler und Inschriften des Totengedenkens bilden im Bestand dieser Edition mit
über 18% als zweitgrößte Gruppe einen durchaus beachtlichen Bestand, wenngleich ihnen, wie
eben bemerkt, längst keine solch zentrale Bedeutung wie in Ostösterreich oder den meisten Inschriftenlandschaften
Deutschlands zukommt113. Mit nur vier Inschriften auf Grabdenkmälern
verschiedener Art vor 1400 und fünf weiteren vor 1450 setzt die Überlieferung verstärkt erst in
der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts ein. Dabei liegt ein auffälliger Schwerpunkt in den 1490er
Jahren114. Insbesondere im späten 15. und 16. Jahrhundert dominiert unter den Typen des Grabdenkmals
die Grabplatte; an ihre Seite treten im Verlauf des 16. und 17. Jahrhunderts zunehmend
andere Arten von Grabdenkmälern.
Vor einem Blick auf die hier edierten Grabdenkmäler soll noch kurz auf die spezifischen Probleme
ihrer Erhaltung eingegangen werden. Offenbar blieben Grabdenkmäler nur solange bedeutsam,
wie die Familie der Verstorbenen Interesse an ihrer Bewahrung zeigen konnte oder wollte;
so haben sich in Stams zahlreiche Grabdenkmäler der Familie Freiberg erhalten, die auch im
Barock noch lebhaftes Interesse an der alten Familiengrablege zeigte, während sich von den
Grabdenkmälern der nachweislich hier beigesetzten Mitglieder der Geschlechter Liebenberg und
Starkenberg auch kopial keinerlei Spuren auffinden ließen. Oft wurden Grabdenkmäler im Zuge
von Baumaßnahmen zerstört; so hat sich in Stams auffälligerweise kein Grabdenkmal eines Abtes
aus der Zeit vor der Barockisierung der Stiftskirche erhalten. Nicht selten wurden Grabplatten
auch später sekundär verwendet, verbaut und/oder zerstört; nur selten hat man diese dann bei
Restaurierungsarbeiten in jüngerer Zeit wieder aufgefunden115.
In Bezug auf die Erhaltung ist auch das Material der Grabdenkmäler von einiger Bedeutung.
Der Großteil der Grabdenkmäler – so etwa alle Grabplatten, Gruftplatten und Grabkreuze –
wurde aus Stein gefertigt, wobei für die meisten Grabdenkmäler mit hohem Anspruch der gut
haltbare rote Marmor verwendet wurde. Nur äußerst selten fanden witterungsanfällige, schlecht
haltbare Steinarten wie Kalksandstein Verwendung, was gegebenenfalls zu entsprechenden Schäden
führte (vgl. etwa Kat.-Nrr. 16 und 312). Dies ist umso bedauerlicher, als die Verwendung
von Kalksandstein in Tirol bereits an sich einen Hinweis auf den Willen zur Distinguierung
bietet116. Bei den Epitaphien ist die Bandbreite der verwendeten Materialien etwas größer. Hier
finden sich neben Steindenkmälern auch auf Holz oder Leinwand gemalte Inschriften. Die wenigen
erhaltenen Totenschilde des Oberlands wurden (wie üblich) aus Holz geschnitzt. Auf die
Tatsache, dass sich nur ein einziges aus Metall gefertigtes Grabdenkmal im Tiroler Oberland erhalten
hat, wird im folgenden Kapitel noch hingewiesen. Ein Kuriosum stellt eine 1543 als
Graffito mit Rötelstift an der Kircheninnenwand von St. Vigil in Obsaurs ausgeführte Grabinschrift
dar (Kat.-Nr. 182).
6.1.1. Typologie der Grabdenkmäler
Blicken wir zunächst auf die verschiedenen Typen an Grabdenkmälern, die im Tiroler Oberland
gebräuchlich waren, und ihre zeitliche (Weiter-)Entwicklung. Dabei wird auch diskutiert werden,
für welche Nutzung, welchen Zweck bzw. welchen Ort in der Kirche diese Grabdenkmäler geschaffen
wurden.
Die ältesten überlieferten Grabinschriften des Bestands datieren vom Ende des 13. Jahrhunderts.
Ihre metrischen Texte zierten die Gräber der landesfürstlichen Familie in Stams (Albert III.
und Meinhard II.; Kat.-Nrr. 3† und 7†), wobei das Aussehen der jeweiligen Inschriftenträger
aufgrund der rein abschriftlichen Überlieferung nicht oder nicht genauer rekonstruiert werden
kann117. Eine weitere versifizierte Grabinschrift lässt sich auch für das ausgehende 15. Jahrhundert
nachweisen (Erzherzog Sigmund; Kat.-Nr. 31†). Im literarischen Anspruch, nicht aber im Aufbau
vergleichbar ist die Inschrift vom Grabdenkmal Herzog Severins von Sachsen aus dem 16. Jahrhundert,
die ebenfalls nur kopial überliefert ist (Kat.-Nr. 58†). Neben diesen Beispielen sind
viele weniger anspruchsvolle Grabinschriften in Prosa zu nennen, so etwa eine stark manipulierte
Inschrift an der Imster Pfarrkirche, die offenbar aus dem 15. Jahrhundert stammt und auch die
Berufsbezeichnung (?) und/oder den Namen des Verstorbenen als meczger nennt, also einem ganz
anderen sozialen Umfeld zuzuordnen sein dürfte (Kat.-Nr. 24). Ein viel knapperes Formular
benützt die Grabinschrift des Johannes Bach von 1458 in Stams: Hier werden nur der Name des
Verstorbenen, der Todestag und das Todesjahr genannt (Kat.-Nr. 21). Mit Wortspielen wartet
dagegen die Grabinschrift des Stiftsapothekers Lambert Statfelder von 1644 auf, die sich an der
Außenwand der Stamser Pfarrkirche erhalten hat (Kat.-Nr. 108).
Das Gros der Grabdenkmäler stellen die Grabplatten dar, die zumeist mit figuralen Darstellungen
der Verstorbenen oder deren Wappen verziert wurden und die zunächst stets eine umlaufende,
nach innen ausgerichtete Inschrift aufweisen, was ihre ursprüngliche Funktion als
Grabmarkierung und Verschluss des Grabschachtes belegt. Im Inschriftenbestand des Oberlandes
lässt sich jedoch der Verlust dieser ursprünglichen Funktion bei gleichzeitiger Beibehaltung des
formalen Aufbaus nahelegen; in der Frühen Neuzeit kam es dann auch zu einem schleichenden
formalen Wandel in der Gestaltung der Grabplatten. Dem älteren Typus entspricht die älteste
erhaltene Grabplatte des Oberlands aus dem Jahr 1348, zugleich eine der frühesten figuralen
Grabplatten des gesamten Tiroler Raums118. Hierbei handelt es sich um einen Stein, der den
gerüsteten Herzog Simon von Teck mit seinem Wappenschild und Schwert in den Händen als
Standfigur zeigt (Kat.-Nr. 8). Nur wenige weitere Beispiel für figurale Grabplatten lassen sich im
Oberland nennen; es sind dies die Grabmonumente zweier Frauen aus der Familie Freiberg ( jene
der Margarethe von Gumpenberg von 1485 im Kreuzgang von Stift Stams, der ersten figuralen
Grabplatte einer Frau in Nordtirol überhaupt119, und der Anna von Grienenstein von 1538 in
Untermieming; Kat.-Nrr. 23 und 46), und es liegt durchaus nahe, hier Auswirkungen einer Familientradition
zu sehen, die auch auf die zweite Familiengrablege der Freiberger in der St.
Anna-Kapelle des Stiftes St. Mang in Füssen wirkte120. Wesentlich häufiger lassen sich jedoch
bereits seit dem 14. Jahrhundert Wappengrabplatten ausmachen, die in verschiedener Ausführlichkeit
von der einfachen graphisch-linearen Darstellung des Wappens bis hin zum tiefen Relief mit
ausladendem Vollwappen samt prunkvoller Helmzier und -decke das Wappen ins Zentrum der
bildlichen Gestaltung setzen. Zwei der ältesten Beispiele hierfür sind im vorliegenden Bestand die
Grabplatten eines Mitglieds der Familie Rubein und eines Angehörigen der Familie Freiberg
(Kat.-Nrr. 10 und 14†). Bereits unter den ältesten Denkmälern dieses Typs lassen sich auch die
verschiedenen Ausführungen mit graphisch-linear eingehauenem Wappen (Grabplatte des Johannes
Steinhauser, um 1400; Kat.-Nr. 13) und aufwändigerem Wappenrelief (Heinrich von
Gachnang, 1416; Kat.-Nr. 16) vorfinden, so dass man am skulpturalen Aufwand der Wappendarstellung
weniger eine zeitliche Entwicklung als vielmehr eine Aussage über die Kosten des jeweiligen
Grabmonuments und daraus mittelbar über den sozialen Status des Verstorbenen ablesen
kann.
Bis auf zwei Ausnahmen stammen alle erhaltenen Grabplatten des Tiroler Oberlands bis zum
letzten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts aus dem unmittelbaren Umfeld von Stift Stams (vgl. auch
Kat.-Nrr. 19†, 22†, 27 und 33†). Erst mit dem Bestand besonders repräsentativer Grabdenkmäler
aus maximilianischer Zeit, die dem Bildhauer Sebald Bocksdorfer zugeschrieben werden, finden
sich auch Grabplatten außerhalb des Stifts. Dabei handelt es sich um die Wappengrabplatte der
Margarethe von Weichs aus Imst von 1494 und jene des Oswald von Schrofenstein in Landeck
von 1497 (Kat.-Nrr. 29 und 141). In Stams hat sich die Grabplatte des Sigmund von Neydeck aus
dem Jahr 1493 erhalten, die ebenfalls Bocksdorfersche Gestaltungsmerkmale aufweist. Für die
Zuschreibung dieses qualitätvollen Grabdenkmals an den produktiven Meister spricht die filigrane
Ausführung des Vollwappens, in dessen Spangenhelm man die Züge eines Gesichts erkennen
kann (Kat.-Nr. 27).
Auch im 16. Jahrhundert lassen sich noch Wappengrabplatten des älteren Typs aus dem 15.
Jahrhundert mit Umschriften nachweisen, so etwa jene des Franz von Spaur in der Rieder Pfarrkirche
von 1551 oder des Georg von Colaus in Tarrenz von 1556 (Kat.-Nrr. 190 und 53), doch
in beiden Fällen handelt es sich um Ausläufer eines überlebten Typus. Bereits mit der Wappengrabplatte
des Ulrich von Tux aus dem Jahr 1516 in Vils und jener der Margarethe Kleinhans von
1517 in Breitenwang setzt sich neben dem Wappen eine mehrzeilige Beschriftung quer zur Längsachse
durch, was die Entwicklung hin zum an der Wand aufgestellten Epitaph belegt (Kat.-Nr.
293f.). Ähnliche Beispiele lassen sich an diesen Orten auch für 1566 und 1587 nachweisen (Kat.-
Nrr. 308 und 312). Aus epigraphischer Sicht ist bemerkenswert, dass sich mit der Wappengrabplatte
des Hans von Hoheneck von 1544 in Vils und jener des Wilhelm Gräfinger von 1598 in
Nauders (Kat.-Nrr. 304 und 222) auch zwei Beispiele für Mischformen erhalten haben. Während
die Inschrift des ersteren Grabdenkmals oben zeilenweise und unten um das Wappenrelief umlaufend
gestaltet wurde, legte man in Nauders ein offensichtlich zeilenweise zu füllendes Schriftfeld
in einer ansonsten konservativ mit umlaufender Inschrift versehenen Grabplatte an. Diese
Tendenz zur zeilenweisen Beschriftung, die nur mehr sehr selten mit einer Umschrift kombiniert
wird, setzt sich im 17. Jahrhundert endgültig durch (s. Kat.-Nrr. 245, 247, 334 und 92). Es drängt
sich damit der Schluss auf, die Veränderung der Anordnung der Schrift ließe auch Aussagen zu
ihrer Funktion zu: Eine zeilenweise angeordnete Inschrift ist im Interesse der Lesbarkeit zweifellos
besser für eine Aufstellung der Grabplatte an der Wand geeignet als die konventionelle Grabplatte
des 15. Jahrhunderts mit ihrer umlaufenden Inschrift. Tatsächlich bieten die unten näher
ausgeführten Befunde für Gruftplatten und Totenschilde weitere Hinweise darauf, dass dieser
Funktionswandel der Grabplatten im Tiroler Oberland schon im Zusammenhang mit deren
Blütezeit in den 1490er Jahren und kurz vor diesem formalen, erstmals 1516 greifbaren Übergang
hin zur zeilenweisen Beschriftung einsetzte.
Unter den Typen der Grabplatten ist abschließend noch jener der durch den Kelch gekennzeichneten
Priestergrabplatte zu nennen, der sich jedoch nur in drei Beispielen – einem aus
Breitenwang von 1519 und zwei weiteren aus Vils von 1523 (Kat.-Nrr. 296† und 298f.) – für das
Oberland belegen lässt. Zu dieser Gruppe mag man auch den im 17. Jahrhundert zu belegenden
Typ der Grabplatte mit Kreuzesdarstellung zählen: Hierbei füllt ein entweder eingehauenes oder
als Metallapplikation ausgeführtes Kreuz die Grabplatte, wie es sich im Fall der in Stams beigesetzten
Äbte nachweisen lässt (Kat.-Nrr. 93 und 107). Auch die in der Vilser Gruft aufgefundene
fragmentierte Grabplatte einer weiblichen Verstorbenen (Kat.-Nr. 301) trug ursprünglich offenbar
Metalleinlagen.
Im Tiroler Oberland haben sich nur zwei Totenschilde erhalten, die sich beide in der Landecker
Pfarrkirche befinden. Dabei handelt es sich zum einen um den Totenschild des Oswald von
Schrofenstein, der wie die entsprechende Wappengrabplatte wohl aus der Werkstatt Sebald Bocksdorfers
stammen dürfte (Kat.-Nr. 140); unter den zahlreichen Zuschreibungen an Bocksdorfer ist
diese auch aufgrund des Umstands überzeugend, dass man einen heute verlorenen Totenschild
von Oswalds Frau, Praxedis von Wolkenstein, aus der Innsbrucker Pfarrkirche archivalisch diesem
Meister zuschreiben kann121. Das Formular des Totenschilds gleicht stark jenem der zugehörigen
Wappengrabplatte (Kat.-Nr. 141). Ein ähnlicher Befund ergibt sich auch beim zweiten Totenschild
aus der Landecker Pfarrkirche, jenem des Leonhard Gienger von 1588 (Kat.-Nr. 210): Der Text
des Totenschilds scheint sich auch auf der Wappengrabplatte Giengers befunden zu haben, soweit
deren fragmentarisch erhaltene Inschrift diesen Schluss noch zulässt (Kat.-Nr. 211).
Noch seltener als die Totenschilde lassen sich im Oberland Gruftplatten ausmachen, und erneut
stammt das einzige Exemplar von 1497 aus der Landecker Pfarrkirche: Es handelt sich dabei um
die Gruftplatte aus dem dreiteiligen Ensemble der Grabdenkmäler des Oswald von Schrofenstein
(Kat.-Nr. 142). Wie auch das Formular des Steins andeutet, handelt es sich hierbei um den tatsächlichen
Verschlussstein der eigentlichen Begräbnisstätte; das flache Relief und die einfache Inschrift
lassen kaum einen Zweifel, dass diese Platte für eine Position im Boden vorgesehen war. Am
Beispiel der Schrofensteiner Grablege in Landeck stellt sich zugleich die Frage, ob eine sichere
formale Unterscheidung von Gruft- und Grabplatte als Verschluss des Grabes im Boden einerseits
und dem Epitaph als an der Wand angebrachtem Grabdenkmal122 möglich ist. Hier liegt mit der
Gruftplatte ein Stein für den Kirchenboden vor, doch ersetzte diese nicht die formal als solche
anzusprechende Wappengrabplatte für denselben Verstorbenen, die vielleicht ebenso wie sein
Totenschild von vornherein bereits für die Aufrichtung an der Wand vorgesehen war; doch behielt
man vorerst die althergebrachte formale Ausgestaltung der Grabplatte mit umlaufender Inschrift
bei, die man jedoch bereits mit den parallel zur Unterkante angeordneten Beischriften der vier
Wappen der Ahnenprobe konterkarierte. Angesichts der immer tiefer unterschnittenen Wappenreliefs
– man denke an die bereits genannten Wappengrabplatten aus der Bocksdorferschen Werkstatt
in Stams und Imst – scheint die Aufstellung der ansonsten ein Hindernis für die gefahrlose
Begehung des Fußbodens darstellenden Grabplatte sich geradezu aufgedrängt zu haben. Dass
dieser Standort- und Funktionswechsel der Grabplatte kurz vor 1500 einsetzte, scheint auch der
zu Beginn des 16. Jahrhunderts einsetzende Usus der zeilenweisen Inschriftengestaltung zu belegen.
Probleme anderer Art offenbart ein Blick auf die sukzessive anwachsende Zahl von einzelnen
Grabmonumenten an adeligen Familiengrablegen. Der Stamser Stiftschronist Primisser berichtet,
dass die Freiberger in ihrer Kapelle so viele Grabdenkmäler („sua sepulcra et lapides sepulcrales“)
aufgerichtet hätten, dass der verfügbare Raum für neue Inschriftenträger geschwunden sei; deshalb
hätten sich drei Brüder der Familie entschlossen, ein gemeinsames Grabdenkmal zu errichten123.
Das bemerkenswerte Grabmonument von 1456, das äußerlich einer Grabplatte ähnelt,
sich aber durch sein aufwändiges Relief mit einem wilden Mann als Schildhalter mit Fahnen der
Familie und mehreren, auch über die engere Ahnenprobe selbst hinausgehenden Wappendarstellungen
als ein stehendes Wandmonument auszeichnet, hat sich bis heute erhalten (Kat.-Nr. 20).
Ein vergleichbares Denkmal etwas bescheideneren Anspruchs, das sich jedoch formal mit seiner
zeilenweisen Beschriftung durchaus nicht an zeitgleichen Grabplatten orientiert, stellt das Grabmonument
der Herren von Eben dar, das trotz seiner traditionsbewussten Nennung des Jahres
1289 wohl erst um 1415 entstand (Kat.-Nr. 15).
Tumben oder Hochgräber mit Inschriften ließen sich im Oberland mit einer fraglichen Ausnahme
überhaupt nicht nachweisen. Der aus konservatorischer Sicht traurige Fall einer Inschrift
auf Fragmenten eines mutmaßlichen Tumbendeckels wohl des ausgehenden 14. Jahrhunderts
(Kat.-Nr. 12), der im Laufe der Arbeiten zu dieser Edition zuerst entdeckt, dann aber unbedacht
weitgehend zerstört wurde, ist umso schmerzlicher, als es sich um die einzigen Reste eines solchen
Denkmaltyps im Bearbeitungsgebiet gehandelt haben dürfte.
Im Bearbeitungsgebiet ließen sich auch nur wenige Epitaphien nachweisen. Eine Übergangsform
von der Grabplatte zum an die Wand gestellten Epitaph mit Andachtsbild stellt Jörg von
Freibergs Grabmonument von 1495 in Stams dar (Kat.-Nr. 30), das neben der Wappendarstellung
auch den gerüsteten Verstorbenen vor dem Schmerzensmann kniend zeigt; durch Spruchbänder
wird die Unterhaltung des auf Gnade hoffenden Verstorbenen mit seinem Heiland ausgedrückt.
Ein ähnliches gestalterisches Motiv – die Anrufung der Gnade Gottes in Form eines Spruchbands
in den Händen des Verstorbenen – lässt sich bereits auf einer Grabplatte aus Rattenberg aus dem
späten 14. Jahrhundert fassen124.
Um ein Epitaph im engeren Sinne könnte es sich bei einem verlorenen Grabdenkmal für
Lienhart von Helmstorff in Pfunds-Stuben von 1566 gehandelt haben (Kat.-Nr. 195†). Erhalten
haben sich dagegen ein epitaphartiges Votivbild der Familie Payr mit Wappen und langer Inschrift
von 1586 in der Totenkapelle von Prutz (Kat.-Nr. 209) sowie das Grabdenkmal der Familie
Zeiler am Friedhof der Pfarrkirche von Breitenwang von 1628 (Kat.-Nr. 333); in beiden Fällen
findet sich neben einem Andachtsbild auch die Stifter- bzw. Beterreihe der Familie des verstorbenen
Paares. Für die Aufstellung an einer Wand der Stiftskirche von Stams konzipierte man auch
das Grabdenkmal des Abtes Melchior Jäger von 1616 (Kat.-Nr. 80), das neben dem Inschriftenfeld
das mit einem Totenschädel unter der Mitra bekrönte Wappen des Abtes zeigt. Singulär für das
Oberland ist ein wohl aus der Werkstatt des Kaspar Gras stammendes Epitaph aus Metall in der
Pfarrkirche von Reutte für Kaspar Bissinger aus dem Jahr 1633 (Kat.-Nr. 335; vgl. allerdings auch
die indirekten Belege in Kat.-Nrr. 58† und 301). Dies ist umso bemerkenswerter, als in Innsbruck
ein potentes lokales Zentrum des Bronzegusses durchaus erreichbar gewesen wäre.
Nur in zwei Beispielen aus Schattwald lässt sich ein weiterer frühneuzeitlicher Typ von
Grabdenkmälern greifen. Es handelt sich dabei um zwei offenbar voneinander abhängige Grabkreuze
aus Stein von 1636, die jeweils mit einer Inschrift auf den Kreuzesarmen versehen sind (Kat.-Nr. 336f.).
6.1.2. Die Inschriften des Totengedenkens und ihr Formular
Das langlebige Standardformular von Grabinschriften125 als Sterbevermerk mit Namen des/der
Verstorbenen und vollständiger Angabe des Sterbetages findet sich im Bearbeitungsgebiet bereits
auf der Grabplatte des Herzogs Simon von Teck (Kat.-Nr. 8). Um 1400 werden dann erstmals
substantivische Attribute als Erweiterung greifbar, wie etwa das saltzmaier auf der Grabplatte des
Johannes Steinhauser (Kat.-Nr. 13). Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts findet sich in den Grabmälern
adeliger Verstorbener ein ständisch definiertes Epitheton als Zusatz beim Namen: Zunächst
ist es ein strenger ritter (Kat.-Nr. 19†), 1456 taucht in einem Denkmal der Freiberger in Stams der
Zusatz edl auf (Kat.-Nr. 20). 1464 folgt in einer Grabinschrift für Parzival von Annenberg die
Titulatur Edl vnd gestreng Ritter Herr (Kat.-Nr. 22†); in der Variante Edel Vnd Vest begegnet er im
Jahr 1493 bei einem anderen einflussreichen Niederadeligen aus Tirol, Sigmund von Neydeck
(Kat.-Nr. 27). Dass sich in diesen Prädikaten die soziale Stellung der Personen ausdrückte, zeigt
recht eindrücklich die Wappengrabplatte der Margarethe von Weichs, die 1494 als die edel fraw
bezeichnet wird, während ihr Mann nur herr jorig puhler genannt wird; offenbar ist sie im Gegensatz
zu ihm altadeliger Herkunft und ihre Familie nicht nur durch den Dienst als Pfleger sozial
aufgestiegen. Neu ist hier auch die dezidierte Nennung ihres Familienstandes als fraw witibin,
dessen Lesung aufgrund der Beschädigung des Steins in diesem Abschnitt jedoch unsicher bleiben
muss (Kat.-Nr. 29). Variationen der Titulaturen Edel und streng bzw. edel und fest gehören dann seit
Ende des 15. Jahrhunderts und im 16. Jahrhundert zum festen Formular adeliger Grabinschriften
(vgl. etwa Kat.-Nrr. 140f., 30, 33†, 294, 304, 190, 210 und 335). Seit Ende des 16. Jahrhunderts
verdichtet sich dieser Titel zu Erenuest oder edlvest und wird so auch mit und firnem ergänzt (vgl.
etwa Kat.-Nrr. 195†, 312, 222 und 245). Bei adeligen Frauen kann sich als Zusatz die Betonung
der ehelichen Tugenden in Form eines ernsam oder thugenreich dazu gesellen (Kat.-Nrr. 46 und
308). Aus dem Formular dieser Inschriften fällt die Grabinschrift des landfremden Hans Fugger
von 1633 heraus (Kat.-Nr. 92), der seinem Stand als Reichsgraf entsprechend als HOCH WOLGEBORN
bezeichnet wird; seine Grabinschrift endet zudem mit dem zur Sentenz gewordenen
lateinischen Bibelzitat O MORS QVAM AMARA EST AEMMORIA (!) TVA, das zwar im
Tiroler Oberland singulär ist, sich aber etwa im Epitaph des Göttweiger Abtes Matthias II. von
Znaim bereits im 16. Jahrhundert oder dem Epitaph des Daniel Knabl, Stadtrichters von Steyr,
von 1673 fassen lässt126. Im Laufe des 17. Jahrhunderts kommt es zu einer gewissen Aufweichung
der früher Adeligen beigegebenen Epitheta, wenn etwa die Mitglieder der Salzfaktorenfamilie
Zeiler sich 1628 als erenvest und fürnemb oder – im Falle der Gemahlin – als Eren-Thugentreich
bezeichnen (Kat.-Nr. 333). Davon abgesetzt begegnet das einfachere Erber, das sich für den offensichtlich
nicht-adeligen Michael Zobel 1636 in Schattwald nachweisen lässt (Kat.-Nr. 337).
Aus den wenigen Beispielen von Grabdenkmälern für Kleriker lässt sich nur schwer eine eigene
Titulatur ableiten. In den drei Beispielen des frühen 16. Jahrhunderts wird Priestern das
Attribut her oder wirdig her beigegeben (Kat.-Nrr. 296† und 298f.). Die knappen Initialen FSAS
für Frater Sigmund, den Abt von Schönthal, scheinen ein formularmäßiger Import aus dem
dortigen Kloster zu sein (Kat.-Nr. 93), wenngleich auch die Stamser Äbte kurze Inschriften auf
ihren Grabplatten bevorzugt zu haben scheinen (vgl. dazu das einzige erhaltene Fragment unter
Kat.-Nr. 107). Das WOLGELERT MAISTER, das sich in der Grabplatte des Ulrich von Tux von
1516 finden lässt (Kat.-Nr. 293), dürfte sich wohl nicht auf dessen Karriere als Geistlicher, sondern
eher auf sein Studium beziehen, wie auch das zweite Beispiel für eine solche Titulatur von 1622
nahe legt: Hier wird Leonhard Bernhart als EDL HOCHGELERT HERR genannt und in der
Inschrift zugleich als Doktor beider Rechte ausgewiesen (Kat.-Nr. 247).
Zu den Erweiterungen im Formular der Grabinschriften gehört seit dem 15. Jahrhundert ein
Segenswunsch, der erstmals auf einer Grabplatte von 1485 in der Form gott genad ir sel amen vorliegt
(Kat.-Nr. 23) und der danach in verschiedenen Varianten praktisch zum festen Kanon der
Grabinschriften gehört127. Dabei wird diese Formel im Laufe des 16. Jahrhunderts immer länger
(etwa 1566: denen baiden der almechtig gott genedig vnd barmherzig sein wel amen; Kat.-Nr. 308). Dem
Trend zu immer umfangreicheren Grabinschriften im Laufe des 16. Jahrhunderts entspricht nicht
nur die ausführliche Beschreibung versehener Ämter, wie sie etwa die Grabplatte des Georg von
Colaus in Tarrenz von 1556 bietet (Kat.-Nr. 53), sondern auch die in zwei Grabplatten aus Vils
nachweisbare Angabe der Sterbestunde (1544: zwischen 11 vnd 12 vr imdag, 1566: vm j vr jm tag;
Kat.-Nrr. 304 und 308). Auch die Nennung des Sterbealters gehört zu dieser zunehmenden Ausführlichkeit
des Formulars, wie es sich auf einer fragmentarisch erhaltenen Grabplatte des 15.
Jahrhunderts aus Vils oder am Grabmonument des Stamser Abtes Melchior Jäger findet (Kat.-Nrr.
301 und 80).
In zwei 1598 und 1617 datierten Grabdenkmälern aus dem Tiroler Oberland verändert sich
das Formular durch Aufnahme eines Setzungsvermerkes, d. h., dass eine weitere Inschrift beigefügt
wird, die den Verstorbenen als Auftraggeber des Monuments nennt (HAT ... DISEN
GRABSTAIN MACHEN LASSEN bzw. noch deutlicher auf den Zweck gerichtet: HAT ...
DISEN GRABSTAIN MACHEN LASSEN ZVR GEDECHTNVS; Kat.-Nrr. 222 und 245).
Diese Grabdenkmäler wurden also auch nach dem Zeugnis der Inschrift selbst zu Lebzeiten des
Toten durch diesen in Auftrag gegeben. Ist damit der Verstorbene bereits in den Mittelpunkt der
Inschrift gerückt, so denkt die Grabinschrift für Maria Magdalena von Hoheneck in Vils von
1629 (Kat.-Nr. 334) diese Entwicklung konsequent zu Ende, indem sie überhaupt in der Ich-Form
formuliert; die Wahl dieser ungewöhnlichen Perspektive dürfte wohl dadurch bedingt sein, dass
es sich um das Grabmonument einer Sechzehnjährigen handelt, weshalb die Inschrift auch nicht
in einer konventionellen Anrufung der göttlichen Gnade, sondern in der an die hinterbliebenen
Eltern gerichteten tröstlichen Feststellung Mir ist wol endet.
Andere Abweichungen vom einfachen Formular der Grabinschriften lassen sich offenbar durch
die Funktion des jeweiligen Grabdenkmals erklären. So beginnt die Inschrift auf der Gruftplatte
des Oswald von Schrofenstein 1497 in Landeck (Kat.-Nr. 142) mit der Grabbezeugung hie lit begrabn,
was auf die direkte Nähe zur tatsächlichen Ruhestätte des Leichnams hinweisen soll128.
Eine ähnliche Formulierung fand sich bereits auf der Grabplatte des Parzival von Annenberg 1464,
die eine Grabbezeugung ans Ende stellt: vnd hie begraben ligt (Kat.-Nr. 22†). In dieser Formulierung
zeigt sich offenbar, dass die Grabplatte von 1464 noch die Funktion einer Grababdeckung im
Boden übernahm – eine Aufgabe, die im Landecker Beispiel 1497 eine Gruftplatte übernommen
hat. Allerdings bringt hier auch die zugehörige Wappengrabplatte den Zusatz Der hie begraben ligt
(Kat.-Nr. 141).
Auf den zwei Grabmonumenten an Familienbegräbnissen in Stams findet sich die Erläuterung,
der Stein verschließe die Grablege des jeweiligen Geschlechts, sei dies wie bei den Herren von
Eben auf Latein (Sepvltvra dominorum de ebn) oder im Falle der Freiberger auf Deutsch eine begrebnus,
deren Bedeutung für die Memoria der Familie noch durch die Nennung nicht nur der
drei das Monument stiftenden Brüder, sondern auch von ir vater mutter vnd auch ir gemachln unterstrichen
wird (Kat.-Nrr. 15 und 20).
6.2. Glocken
Verglichen mit anderen Gebieten sind die Verluste an historischen Glocken im Tiroler Oberland
relativ gering; von den 57 beschrifteten Glocken sind lediglich 17, also etwas mehr als ein Viertel,
nur mehr kopial zu erschließen129. Überraschend ist die Verteilung der Glockeninschriften auf
die drei hier berücksichtigten Politischen Bezirke. Besonders fällt die hohe Zahl an Glocken im
ansonsten eher inschriftenarmen Bezirk Reutte auf. Hier stellen die Glockeninschriften ein
Viertel des gesamten epigraphischen Bestandes. Absolut gesehen lassen sich fast gleich viele Glocken
in den Bezirken Landeck und Reutte fassen. Deutlich bleibt dagegen der Bezirk Imst zurück,
der nur rund ein Fünftel der Glockeninschriften dieser Edition stellt (vgl. Tab. 6).
Dieses Ungleichgewicht dürfte sich am ehesten durch die Nähe des Bezirks Imst zur Landeshauptstadt
Innsbruck erklären lassen: Die Glockenablieferungen der beiden Weltkriege betrafen
insbesondere jene Glocken, die in weniger entlegenen Gebieten aufgehängt waren und somit
leichter in die Gießereien abtransportiert werden konnten. Offenbar war dies in den Bezirken
Landeck und Reutte nur mit so hohem Aufwand umzusetzen, dass man den Altbestand an Glocken
hier erfolgreicher bewahren konnte. Besonders schwierig war es für die Tiroler Denkmalschützer,
ganze Geläute zu erhalten; dies gelang jedoch insbesondere in Tannheim im Bezirk
Reutte, wo durch den Einsatz des Denkmalamtes unter Oswald Trapp das gesamte Löffler-Geläute
vor der Einschmelzung zu Rüstungszwecken im Zweiten Weltkrieg bewahrt werden konnte130.
Gerade von dieser Glockenaktion haben sich – wie bereits weiter oben erwähnt131 – im
Landeskonservatorat für Tirol zahlreiche Fotografien und Abpausungen der abgenommenen Glocken
erhalten, die u. a. die Zuordnung einer bislang weitgehend unbeachteten Glocke an die
Gießerei Heinrich Reinharts ermöglichten (Kat.-Nr. 70†).
Besonders erfreulich ist es, dass mit dem Erscheinen dieses Bandes nun erstmals wesentliche
Neuansätze für die Reihung der ältesten Tiroler Glocken erfolgen konnten: So gelang es nicht
nur, die Lesung des bislang als älteste Glocke Nordtirols geltenden Lermooser Instruments von
1411 zu stützen (Kat.-Nr. 281), sondern aufgrund inschriftenpaläographischer Überlegungen auch
noch mit einer bislang für deutlich jünger gehaltenen Glocke aus Lechaschau einen noch älteren
Vorläufer im Bezirk Reutte ausfindig zu machen (Kat.-Nr. 280). Beiden Glocken gebührt jedoch
nicht der Titel einer ältesten Glocke in Tirol, denn eine bislang im Wesentlichen unbeachtete
Glocke aus dem Dachreiter von Stams lässt ihren Ursprung Ende des 13. Jahrhunderts vermuten;
damit dürfte es sich sogar noch um eine Glocke aus dem Gründungsbestand des Klosters handeln
(Kat.-Nr. 5).

Auf die spezifischen Schwierigkeiten bei der Aufnahme von Glockeninschriften im Oberland wird
später noch ausführlicher einzugehen sein132; im folgenden Abschnitt werden hingegen das Formular
der Glockeninschriften, die epigraphisch fassbaren Glockengießer und Fehler bei der Ausführung
gegossener Inschriften genauer betrachtet.
6.2.1. Formular der Glockeninschriften
Die Glockeninschriften sollten in den meisten Fällen die apotropäische Funktion des Glockenläutens
unterstreichen. Die älteren Glockeninschriften des 15. Jahrhunderts sind zunächst nur in
Latein abgefasst; danach entwickelt sich gerade auf Glocken zumeist ein Nebeneinander deutschsprachiger
und lateinischer Inschriften133. In der Frühen Neuzeit erhält dabei zumeist die lateinische
Inschrift einen apotropäischen Charakter, während die Gießernennung deutschsprachig abgefasst
wurde. Dies kann im epigraphischen Bestand entweder durch zwei getrennte Inschriften
oder durch eine in zwei unterschiedlichen Sprachen abgefasste Inschrift umgesetzt werden; dabei
finden zumeist unterschiedliche Schrifttypen Verwendung, also etwa eine Kapitalis für den lateinischen,
dagegen eine Fraktur für den deutschsprachigen Inschriftenteil.
Die ältesten Glockeninschriften bestehen vor allem aus einfachen Aneinanderreihungen von
Heiligennamen, wobei sich die Evangelisten besonderer Beliebtheit erfreuen (Kat.-Nrr. 5, 280
und 289). Unter den ebenfalls schon für das 15. Jahrhundert belegten Anrufungsformeln findet
sich mit Abstand am häufigsten eine Variation der Gebetsbitte O rex glorie Christe veni cum pace,
wobei Christe bisweilen auch entfällt (zu den ältesten Belegen in den drei Bezirken vgl. Kat.-Nrr.
280, 37 und 145). In der Beliebtheitsskala folgt nach diesen älteren Texten der Englische Gruß
Maria gratia plena dominus tecum, der sich erstmals 1484 auf einer Glocke aus Lechaschau findet
(Kat.-Nrr. 285, 151 und 231). Inhaltlich ähnlich begegnet die Anrufung Mariens auch in einer
kopial überlieferten gereimten deutschen Variante des 16. Jahrhunderts aus Holzgau: Maria Gottes
Zel Behüet Was Ich Gloc Ueberschel (Kat.-Nr. 315†). Mitunter wurde auch eine gemeinsame Anrufung
der Gottesmutter Maria und ihres Sohnes Christus ausgedrückt (Kat.-Nrr. 291 und 173).
Die Anrufung Christi kann vereinzelt mit jener des Heiligen Geistes zusammenfallen, wie 1524
auf einer Glocke aus Vils (Kat.-Nr. 291). Der Heilige Geist wird aber auch alleine apostrophiert
(Kat.-Nr. 302†). Auf den Heiligen Geist spielen auch die vereinzelt überlieferten Inschriften vom
Typ mentem sanctam spontaneam honorem deo et patriae liberationem an (Kat.-Nrr. 203 und 309). Daneben
finden sich zahlreiche andere apotropäische Inschriften mitunter hymnischen Zuschnitts,
die Gott als Weltenlenker anrufen (rector celi nos exaudi, 1494 in Lähn bei Bichlbach; Kat.-Nr. 288)
oder die Funktion der Glocke etwa als Wetterwenderin und Blitzabwehrerin thematisieren (Kat.-
Nrr. 255†, 307, 314† und 338†).
Eine Textsorte, die sich insbesondere im 17. Jahrhundert großer Beliebtheit als Glockeninschrift
erfreut und nur mehr indirekt auf den apotropäischen Charakter der Glocke eingeht, stellt der
Lobpreis Gottes dar, wie er erstmals im Oberland auf einer Löffler-Glocke aus Namlos von 1553
in Form des DEO SOLI GLORIA begegnet135. Eine verlorene Grinser Glocke von 1632 gehörte
mit ihrem Psalmenzitat ebenfalls zu dieser Gruppe (Kat.-Nr. 255†). Zum häufig gebrauchten Formular
erhebt einen am Rande hierher gehörigen Spruch der Innsbrucker Gießer Heinrich
Reinhart am Beginn des 17. Jahrhunderts; eine an seinen Instrumenten oft angebrachte Inschrift
lautet (wiederum in verschiedenen Varianten): Zu Gottes ehr und dienst geher ich, Heinrich Reinhart
zu Innsbruck gus mich (Kat.-Nrr. 90, 233, 238f. und 249), was sogar die Zuschreibung einer in
ihrer Inschrift nur mehr fragmentarisch greifbaren Glocke aus Wenns an seine Gießerwerkstatt
ermöglicht (Kat.-Nr. 70†).
Sehr selten sind hingegen Glockeninschriften, die keinerlei Gottesbezug aufweisen. Neben der
gelegentlich vorkommenden Angabe des Gussjahres oder lediglich des Gießers sei hier eine Inschrift
aus Fiss von 1581 als Beispiel für eine weitverbreitete gereimte Glockenrede zitiert: Aus
dem Feuer bin ich geflossen, zu Kempten bin ich gegossen (Kat.-Nr. 207). Auffällig am Formular der
Glockeninschriften ist, dass sie wesentlich häufiger den Gießer als den Stifter nennen.
6.2.2. Glockengießer
Blickt man auf die im Bearbeitungsgebiet vertretenen Glockengießer, so treten hier besonders
deutlich die über die Grenzen Tirols hinausreichenden kulturellen Verbindungen des Oberlands
zu Tage. Gerade die ersten namentlich bekannten Gießer des 15. Jahrhunderts stammen aus Ulm
( Johannes Frädenberger, Glocke in der Galtürer Pfarrkirche von 1441; Kat.-Nr. 132), aus Augsburg
(Stefan Wiggau, Lechaschau 1484, sowie Christian Kessler samt Hans und Laux Zotman,
Ladis 1499; Kat.-Nrr. 285 und 143) oder aus München (Ulrich von Rosen, Lähn bei Bichlbach
1494, Kat.-Nr. 288). Der nur einmal in einer kopial überlieferten Glockeninschrift von 1519 aus
Karres genannte Hans Reiter konnte nicht genauer zugeordnet werden (Kat.-Nr. 44†).
Der Aufstieg des Glockengusses in Tirol verbindet sich dagegen mit der ersten großen Glockengießerdynastie
des 16. Jahrhunderts in Innsbruck, der Familie Löffler. Deren Mitglieder
wurden nun rasch zu den Hauptlieferanten der Oberländer Glocken, auch wenn die Zuschreibung
einer Glocke aus Vils von 1524 an Mitglieder der Familie Löffler wohl nicht haltbar ist (Kat.-Nr.
300). In den folgenden Jahrzehnten kommt es zu zahlreichen Glockengüssen durch Gregor
Löffler und seine Söhne Hans Christoph und Elias, die in wechselnden Konstellationen Glocken
für die Kirchen in Weer (1553, heute in Namlos135), Berwang (1557) und Tannheim (1561) herstellen
(Kat.-Nr. 306f.). Mit Tannheim verbindet sich dann auch der Name der Löffler in besonderer
Weise, da sich hier das berühmte Löfflergeläute erhalten hat; es wurde 1580 von Hans
Christoph Löffler gegossen, aus dessen Gießerei sich auch eine große Anzahl weiterer Glocken
des Oberlands zwischen 1562 und 1590 erhalten hat (Kat.-Nrr. 192, 200, 203, 309–311, 207 und
63). Ein sehr produktives Mitglied der Familie war auch der bereits 1543 verstorbene Alexander
Löffler, der sich in den 1530er Jahren als selbständiger Gießer in Südtirol niederließ; von ihm
stammen zwei Glocken in der Nauderer Pfarrkirche (1533) und der Margarethenkapelle in Pians
(1539) (Kat.-Nrr. 173 und 177).
Einhergehend mit der Produktion der Löfflerschen Gießerei können wir gegen Ende des 16.
Jahrhunderts dann wieder vermehrt auswärtige Gießer epigraphisch nachweisen. So goss ein
Kemptner Gießer 1581 eine Glocke für Fiss (Kat.-Nr. 209†) und der Feldkircher Gießer Georg
Hauser lässt sich für 1591 und 1602 im Oberland nachweisen – damit ist es übrigens gelungen,
die Tätigkeit Georg Hausers bereits zwei Jahre früher als bisher nachzuweisen (Kat.-Nrr. 64† und
231). Aus Augsburg stammte auch Wolfgang Neidhart, der Gießer des Salzburger Domgeläutes,
der sich mit einer Glocke in Breitenwang von 1597 und einer in Barwies 1617 als Hersteller
greifen lässt (Kat.-Nrr. 314† und 81).
Die Löfflersche Gießerei in Innsbruck war mittlerweile von Heinrich Reinhart übernommen
worden, der mit seinen Glocken wiederum zahlreiche Aufträge für das Tiroler Oberland ausführte:
Nicht weniger als sieben Oberländer Glocken lassen sich für einen Zeitraum von 1602 bis
1626 diesem Gießer zuschreiben (Kat.-Nrr. 70†, 233, 238f., 325, 249 und 90). Unter den Innsbrucker
Gießern des 17. Jahrhunderts ist auch Friedrich Reinhart zu nennen, der 1637 zwei
Serfauser Glocken schuf (Kat.-Nrr. 260 und 261†). Nach ihm ist es vor allem Bartlmä (Bartholomäus)
Köttelath, mit dem sich die Innsbrucker Dominanz in der Glockenzulieferung gegen Mitte
des Jahrhunderts fortsetzt (Kat.-Nrr. 269, 339 und 278). Neben diesen Innsbrucker Gießern
lässt sich für Grins auch ein lothringischer Wandergießer, Elias Sermosius, mit zwei Glocken von
1632 fassen (Kat.-Nrr. 255† und 256†).
Eine Konstante des Tiroler Glockengießergewerbes stellt eine weitere bedeutende Innsbrucker
Glockengießerfamilie dar, deren Betrieb noch heute besteht: Es handelt sich um die Familie Grassmayr136.
Zwar haben sich von dieser aus dem Ötztal stammenden Familie keine Glocken aus dem
Editionszeitraum im Oberland erhalten, doch ist ihre Geschichte dennoch in zweifacher Hinsicht
für die vorliegende Edition von Belang: Einmal betreibt die Familie ein Glockenmuseum in Innsbruck,
in dem sich auch einige der hier aufgenommenen Oberländer Glocken erhalten haben;
andererseits ist das Stammhaus der Familie in Habichen reich mit Fassadenmalereien des 17. Jahrhunderts
verziert, die hier ebenfalls behandelt werden; dabei beziehen sich die Darstellungen
dieser Malereien durchaus auch auf das Gewerbe der Familie (Kat.-Nr. 95).
6.2.3. Fehler bei der Ausführung gegossener Inschriften
Eine Besonderheit der Glockeninschriften ist die offensichtlich besonders große Schwierigkeit
ihres korrekten Gusses bzw. die geringe Aufmerksamkeit, die dieser scheinbar mitunter genoss137.
So lassen sich immer wieder Defekte bei Ausführung der Inschriften feststellen; auch die Glocken
im Tiroler Oberland machen hier keine Ausnahme. Dies zeigt sich etwa an einer Glockeninschrift
aus der Pfarrkirche von Pettneu am Arlberg aus dem Jahr 1611: Hier wurde das IAR der Datierung
zu IRA verschrieben (Kat.-Nr. 238). Die wahrscheinlich aus dem späten 13. Jahrhundert stammende
Glocke im Glockenturm der Stamser Stiftskirche (Kat.-Nr. 5) trägt neben den in gewohnter
Leserichtung gegossenen Evangelistennamen auch ein SANCTA MARIA, das wohl
apotropäischen Vorstellungen entsprechend rückläufig in die Hohlform geritzt wurde, wobei das
retrograde C offenbar ein Versehen darstellt.
6.3. Kirchliche Ausstattungsgegenstände und liturgische Geräte
Zusammen mit den Inschriften auf Grabdenkmälern und Glocken gehören die beschrifteten
kirchlichen Ausstattungsgegenstände zu den drei etwa gleich großen Gruppen mit rund 15–18%
des Bestandes. Es versteht sich von selbst, dass sich hinter dieser Zahl die reiche Ausstattung insbesondere
der Pfarrkirchen im Tiroler Oberland verbirgt, und es verwundert wenig, dass gerade
das Kloster Stams mit seinen Beständen einen erheblichen Anteil zu dieser Inschriftengruppe
beiträgt. Allerdings fällt die hohe Zahl an Ausstattungsgegenständen hohen Alters auch in kleineren
Filialkirchen und Kapellen auf, die den künstlerischen Reichtum der Region in der Zeit
der Spätgotik und des Frühbarock spiegeln.
Die ältesten Inschriften dieser Gruppe befinden sich auf jenen Objekten, die mehr oder weniger
direkt mit den Anfängen der Zisterze Stams zusammenhängen. So wurde zumindest kopial
eine metrische Inschrift von 1288 überliefert, die sich auf dem Brunnen im Kreuzgang des
Stiftes befand; sie unterstreicht die besondere Bedeutung, die dem Brunnen im mittelalterlichen
Klostergebäude zukam (Kat.-Nr. 4†). Unmittelbar aus der Gründungsausstattung stammt vielleicht
auch ein heute im Stiftsmuseum aufbewahrter „Lasterteller“, eine sogenannte Hansaschüssel, die
in grober Gravur die Namen von vier darauf abgebildeten Lastern wiedergibt (Kat.-Nr. 6).
Im 14. Jahrhundert bricht die Überlieferung dieser Inschriftengattung ab, um erst wieder mit
dem Bauboom der Spätgotik seit der Mitte des 15. Jahrhunderts und einer zugehörigen Welle
neuer Kirchenausstattungen einzusetzen. Doch liegt der sehr frühe Beleg einer Jahreszahl in arabischen
Ziffern auf einer deutlich älteren, romanischen Madonna noch vor diesem Zeithorizont.
Die an der Rückseite der Statue in der Serfauser Wallfahrtskirche eingeritzte Jahresangabe (1)427
bezieht sich wahrscheinlich auf eine farbige Neufassung der Plastik (Kat.-Nr. 126).
Unter den hierher gehörenden epigraphischen Zeugnissen des 15. Jahrhunderts befinden sich
dann auch wieder mehrere Stamser Objekte. Eine Kreuzigungstafel von 1430/40 im Stiftsmuseum,
die ein Pendant in der etwas früheren Wiltener Kreuzigung im Unteren Belvedere in Wien besitzt,
weist vor allem ein Spruchband mit dem vere filius dei erat iste auf und bezieht die Szene damit
direkt auf einen bestimmten Moment in den Evangelien (Kat.-Nr. 18). Ein epigraphisch ähnlich
aufbereitetes Thema findet sich auch in einer Wandmalerei in der Stubener Pfarrkirche (Kat.-Nr.
147), was die Bindung des Inschriftenformulars an die Ikonographie (und nicht deren Bindung
an den Inschriftenträger) belegt. Ähnlich verhält es sich bei einem 1595 datierten Bergkristallkreuz,
das neben der Stifterinschrift die Worte Christi am Kreuz ELI, ELI, LAMMAA SABTHANI
aufweist (Kat.-Nr. 66). Ebenfalls im Stiftsmuseum Stams befindet sich auch ein Pedum
von 1603 mit Initialen (des ausführenden Handwerkers?) und Jahreszahl an der Oberseite der
Krümme (Kat.-Nr. 71). Eine Reihe von Abtportraits des frühen 17. Jahrhunderts im Klausurtrakt
des Stiftes weist neben erneuerten Hauptinschriften als Originalbestand mehrere Inschriften als
Texte der im Bild dargestellten aufgeschlagenen Bücher und Briefe auf (Kat.-Nr. 99–106 und
113).
An Inschriften auf liturgischen Gewändern ließ sich nur ein einziges, wenn auch aufgrund
seiner Machart besonderes Beispiel fassen, eine wohl für den Vollzug der Freiberger Jahrtagverbindlichkeiten
in Stams vorgesehene Kasel mit einer nach einem Vesalschen Vorbild gestalteten
Skelettfigur und Stifterinschrift von 1623 (Kat.-Nr. 88). Sie ähnelt einem Stück in Kremsmünster
aus der Werkstatt des Augsburger Meisters Johann Jakob Pfalzer, der wohl auch das Stamser Objekt
anfertigte.
In drei Fällen haben sich knappe Inschriften auf Prozessionsstangen erhalten, die aus Galtür
(1598) bzw. aus Serfaus (1617) stammen (Kat.-Nrr. 224 und 244†). Ähnlich wie die Inschriften
auf den sogenannten Pestleuchtern der Pfarrkirche von Breitenwang, die ebenfalls in das 17. Jahrhundert
datieren (Kat.-Nr. 322), handelt es sich dabei um bisweilen um Initialen erweiterte einfache
Jahreszahlen. Die Initialen dürften dabei wohl auf die Stifter oder die ausführenden Handwerker
hinweisen. Als Stifter zweier Objekte (ein Kruzifix am Triumphbogen, eine Georgsfigur)
für die Kapelle St. Georgen ob Tösens wird inschriftlich ein Jörg Schwarz ausgewiesen (Kat.-Nrr.
254 und 257).
Zur Kirchenausstattung im weiteren Sinn gehören Inschriften wie jene am Eisengitter einer
Kapelle in Prutz von 1615, die den ausführenden Schlosser nennt, sowie zwei Inschriften auf
einem Beichtstuhl (Stifterinschrift von 1648) aus Landeck und einem Sakristeischrank ( Jesusmonogramm
von 1653) aus Silz (Kat.-Nrr. 243, 272 und 111).
Bei dem einzigen Reliquiar aus dem Untersuchungszeitraum, auf dem sich eine Inschrift ausmachen
ließ, handelt es sich um ein kurioses Stück: Das wohl um 1600 entstandene Stephanus-
Reliquiar mit einer wahrscheinlich einer karolingerzeitlichen Schenkung entstammenden Reliquie
aus Kloster Prüm fand durch die Wirren der Koalitionskriege seinen Weg in die Pfarrkirche
von Ischgl. Auf dem kostbaren Armreliquiar befindet sich ein vollrundes Sichtfenster mit der
Umschrift BRACHIVM S(ANCTI) STEPHANI PROTO MARTGRIS (Kat.-Nr. 230).
6.3.1. Taufsteine
Haupttypen orientierten Taufsteine dar, die trotz der Umbauten etwa des Barock oder des 19.
Jahrhunderts noch häufig im Oberland erhalten blieben. Hier lassen sich formal vor allem die
Objekte in Serfaus, Elbigenalp und Holzgau, die ein halbkugelförmiges Becken aufweisen, von
den spätgotischen polygonal gestalteten Beispielen unterscheiden. Der Taufstein in der Serfauser
Wallfahrtskirche fällt dabei sowohl durch sein höheres Alter (1403?) als auch durch die Nennung
seines nicht näher zu identifizierenden Stifters (?), Hans Waltl von Serfaus, als ungewöhnlich auf
(Kat.-Nr. 124). Dagegen sind die Taufsteine aus Holzgau (zwischen 1435 und 1439) und Elbigenalp
(1440) von der äußeren Gestaltung her direkt voneinander abhängig (Kat.-Nr. 283f.). Der
epigraphische Befund zeigt jedoch erhebliche Unterschiede: Während die Inschrift in Holzgau in
deutscher Sprache abgefasst wurde und direkt auf den ausführenden Handwerker oder wohl eher
den Stifter hinweist (disen stain hat gemacht), ist die Inschrift am Taufstein in Elbigenalp in Latein
gehalten und bezieht sich auf die liturgische Funktion des Beckens. Damit drückt sich in den
Taufsteinen sowohl die Verbundenheit als auch die Konkurrenz der beiden Pfarrkirchen aus,
deren Pfarrsprengel erst 1401 vom Bischof von Augsburg getrennt worden waren138. Bemerkenswert
ist, dass der ältere Taufstein offenbar in der jüngeren, abgespaltenen Pfarre Holzgau entstand,
woraufhin man sich offensichtlich in Elbigenalp nicht nur genötigt sah, einen vergleichbaren
Gegenstand anfertigen zu lassen, sondern sich auch gleich durch eine lateinisch abgefasste Inschrift
von der jüngeren Pfarre zu distinguieren.
Die jüngere, spätgotische Gruppe mit oktogonalem Becken lässt sich im 16. Jahrhundert mit
den fünf Exemplaren in Landeck (1506?), Nassereith (1507), Fließ (1523), Kappl (1575) und Rietz
(1581) belegen (Kat.-Nrr. 158, 39, 167, 201 und 62); ihr oktogonaler Aufbau verweist auf die Acht
als Zahl der Erlösung, an der der Täufling durch das hier gespendete Sakrament Anteil hat139.
Die spätgotischen Tauf becken besitzen zumeist eine Datierung und mehrere Wappendarstellungen,
die mit den Namen der jeweiligen Geschlechter und Herrschaften versehen wurden. Nur
im Falle des Kappler Taufsteins findet sich auch eine Inschrift, die – wie am älteren Taufstein in
Elbigenalp – direkt auf die Funktion des Gegenstandes abhebt.
6.3.2. Altäre
Unter den kirchlichen Ausstattungsgegenständen nehmen die Altäre einen besonderen Platz ein;
auf ihnen findet sich häufig eine große Anzahl von Inschriften. Wie bei den Wandmalereien140
handelt es sich dabei häufig um Tituli zu Heiligenfiguren (etwa Kat.-Nrr. 11, 327† und 263),
vereinzelt umgeformt in eine Heiligenanrufung wie am linken Seitenaltar der Hüttkapelle in
Pflach aus der Zeit um 1618 (Kat.-Nr. 326†). Im Gegensatz zu den Darstellungen der Wandmalereien
finden sich auf den Altarblättern jedoch häufig Details, deren Darstellung durch die andere
Maltechnik auf Holz bzw. Leinwand ermöglicht wird. Hierzu zählt etwa das häufig wiederkehrende
Motiv der Engel mit Notenblatt in der Hand; dabei tragen diese Notenblätter neben
Noten auch häufig den Text des Liedes. Insbesondere die Anfangszeilen des Gloria tauchen hier
entsprechend der Verkündigung an die Hirten nach dem Lukasevangelium141 auf, so im Weihnachtsbild
des „Defensoriums“ in Stams (1426), der Mitteltafel des ehemaligen Hochaltars der
Landecker Pfarrkirche (1504) und auf dem um 1620 entstandenen sogenannten Feldaltar Erzherzog
Maximilians III. in Stams (Kat.-Nrr. 17, 153 und 82). Auf der „Grussit-Tafel“ in Stams
mit der Darstellung einer Marienkrönung von 1388 (?) findet sich hingegen der Text des Hymnus
Regina celi letare in den Händen der Engel (Kat.-Nr. 11). Zu den durch die Maltechnik ermöglichten
epigraphischen Details gehören zudem versteckte, oftmals nur wenige Millimeter große
Inschriften wie jener aus gemalten Perlen geformte Titulus, den nur der aufmerksame Betrachter
bei intensivem Studium der Stamser Grussit-Tafel im Kronreif der Hl. Agnes vorfinden kann.
Auch die Gewandsauminschriften auf der Mitteltafel des Landecker Hochaltars von 1504 sind hier
zu nennen (Kat.-Nr. 153).
Häufig finden sich gut sichtbar angebrachte Stifterinschriften auf den Altären, so auf dem
heute im Meraner Stadtmuseum aufbewahrten Altar der Landecker Burgkapelle von 1537, am
rechten Seitenaltar der Martinskapelle in Tschafein von 1624, dem vom Stamser Abt Paul Gay
1633 gestifteten Altar mit dem Amplexus des Hl. Bernhard von Clairvaux in Haiming, auf dem
rechten Seitenaltar der Leonhardskapelle in Nauders von 1651 oder an zwei Altären der Landecker
Burschlkirche von 1651 bzw. 1652 (Kat.-Nrr. 174, 248, 94, 258, 274f.).
Neben diesen ausführlichen Inschriften lassen sich auch einfache Datierungen der Objekte
finden, wie dies etwa am Stamser Hochaltar und zwei weiteren Altären des Oberlands der Fall
ist (Kat.-Nrr. 77†, 78 und 153). Die Datierung wird mitunter von einer Nennung der ausführenden
Künstler oder deren Signatur begleitet; besonders ausführlich geschah dies etwa an der Rückseite
des Altares in der Rochuskapelle in Biberwier von 1618 (Kat.-Nr. 324) und am ehemaligen
Altarbild aus der Annakapelle in Vils von 1625 (Kat.-Nr. 330).
Unter den Altären lassen sich zwei aus epigraphischer Sicht besonders bemerkenswerte Fälle
herausgreifen. Zum einen handelt es sich dabei um den bereits genannten „Feldaltar“ Erzherzog
Maximilians III. aus der Zeit um 1620, der neben der hohen Qualität der Darstellung auch längere
Inschriften mit ähnlich hohem Anspruch aufweist (Kat.-Nr. 82). Andererseits ist hier wiederum
das „Defensorium“ aus Stams zu nennen. Als Vorlage für diesen 1426 gestifteten Altar
diente ein zeitgenössischer Traktat, das „Defensorium Inviolatae Virginitatis Mariae“ des Wiener
Dominikaners Franz von Retz, was ein kompliziertes Bild-Text-Programm ergab. Ziel des Traktats
– und damit des hier besprochenen Altars – ist es, mit Exempla aus dem Alten Testament
sowie aus der Tier- und Pflanzenwelt die Möglichkeit der Jungfräulichkeit Mariens zu belegen.
Der Stamser Altar stellt zugleich die älteste Überlieferung dieses Traktats dar, da der Urtext des
Franz von Retz verloren ging. Umso verwunderlicher ist es, dass die Forschung bislang nur
wenig Notiz von diesem singulären Denkmal genommen hat (Kat.-Nr. 17).
6.4. Inschriften an Gebäuden
Mit rund 31% der Katalognummern handelt es sich bei den Inschriften an Gebäuden um die mit
Abstand größte Inschriftengattung des Tiroler Oberlands; auf die Besonderheit dieses Umstands
insbesondere im Gegensatz zu den ostösterreichischen Inschriftenlandschaften ist bereits weiter
oben hingewiesen worden142. Gerade die reichen spätgotischen Wandmalerei-Zyklen im Innenund
Außenraum der Kirchen, aber auch die Tradition der Fassadenmalereien an repräsentativen
Bauern- und Wirtshäusern im Frühbarock spiegeln sich in dieser Dominanz der Gebäudeinschriften.
Da es sich damit um den wichtigsten Bereich der epigraphischen Überlieferung aus den
Bezirken Imst, Landeck und Reutte handelt, wird hier vor der Besprechung der Inschriften getrennt
nach dem kirchlichen und profanen Bereich (Kapitel 6.4.2. und 6.4.3.) die Überlieferung
insbesondere der gemalten143 Inschriften an Gebäuden problematisiert.
6.4.1. Überlieferungsproblematik der (gemalten) Gebäudeinschriften
Die unterschiedliche Gewichtung der Inschriftengattungen gegenüber dem ostösterreichischen
Raum bringt es mit sich, dass die Bearbeiter dieses Bandes anderen Hauptschwierigkeiten bei der
Aufnahme gegenüberstanden, als dies in Ostösterreich der Fall ist. Handelt es sich bei den dort
vorrangig auftretenden Grabdenkmälern naturgemäß vor allem um steinerne Zeugen der Vergangenheit,
bringen die zumeist gemalten Gebäudeinschriften in viel größerem Ausmaß die Probleme
fragmentarischer Erhaltung mit sich. Die die größte Gruppe unter den Gebäudeinschriften
ausmachenden Beischriften zu Wandmalereien haben – fast durchwegs in Secco-Technik ausgeführt
– nur in wenigen Fällen keine Beschädigungen erlitten. Elga Lanc fasste das Problem folgendermaßen
zusammen: „Dass Schriftzeilen naturgemäß erst nach Fertigstellung der Wandgemälde
in Spruchbändern über der Malschicht bzw. an der Wand aufgetragen wurden, hatte ihre
geringere Haftung auf dem bereits trockenen Grund zur Folge, weshalb ein großer Teil von ihnen
verloren ging.“144 Zu diesen Schwierigkeiten der Erhaltung im engeren Sinne treten jedoch auch
gerade im ländlichen Raum oft unsachgemäß ausgeführte Restaurierungen hinzu. Hat eine
mittelalterliche Wandmalerei Jahrhunderte lang etwa unter barockem Putz überdauert, so folgt
der Aufdeckung nicht selten eine Restaurierung, bei der die Inschriften eine unbedarfte Behandlung
im Sinne besserer Lesbarkeit der Texte erfahren; gerade das durchaus wohlwollende Nachziehen
vermeintlich sicher erkennbarer Buchstabenteile hat bei Schriften wie der gotischen Minuskel
deren praktisch totale Unlesbarkeit zur Folge, auch wenn der optische Gesamteindruck der
Schrift oberflächlich erhalten blieb. So ist etwa eine spätgotische Grabinschrift an der Imster
Pfarrkirche kaum mehr sinnvoll zu lesen, obwohl die Buchstaben deutlich erkennbar zu sein
scheinen (Kat.-Nr. 24). Ein abschreckendes Beispiel stammt aus der Pfarrkirche von Umhausen:
Eine Bildunterschrift aus dem 16. Jahrhundert lässt sich hier nach mehrfacher Überarbeitung nur
mehr als möLeherKVPrl lesen – auch eine epigraphische Detailuntersuchung kann hier nichts mehr
zur Klärung der ursprünglichen Inschrift beitragen145. Ein weniger dramatisches Beispiel dafür
sind zwei der Inschriften (nämlich III und IV) auf dem Zeiler-Epitaph am Friedhof der Pfarrkirche
Breitenwang (Kat.-Nr. 333). Doch selbst bei sachgemäßer Restaurierung nicht nur der
bildlichen Darstellungen, sondern auch von deren Beischriften bleiben grundsätzliche Probleme
der Konservierung bestehen, wie eine Wandmalerei in der Pfarrkirche von Stuben zeigt: Spruchbänder
auf einem der gotischen Wandgemälde, die 1912 aufgedeckt wurden, waren nach der
Restaurierung von 1970 noch ausgezeichnet zu lesen – heute belegen dies nur mehr die damals
angefertigten Fotos aus dem Bildarchiv des Landeskonservatorats für Tirol in Innsbruck (Kat.-Nr.
148). Die Notwendigkeit der möglichst eingehenden Aufnahme gerade der gemalten Inschriften
wird am Bestand des Tiroler Oberlandes somit überdeutlich.
6.4.2. Inschriften in und an Kirchen
Grundsätzlich lassen sich nach Elga Lanc Inschriften in bzw. bei Wandmalereien in zwei große
Gruppen trennen: Die Inschriften, die weitgehend unabhängig von Wandmalereien angebracht
wurden, und jene, die im unmittelbaren Kontext mit der Malerei stehen, sich direkt inhaltlich
auf diese beziehen oder diese ergänzen146.
Zur ersteren Gruppe gehören etwa die Weiheinschriften bzw. Reliquienkataloge, die sich in
der romanischen Mittelapsis der Stamser Stiftskirche aus dem späten 13. Jahrhundert und in St.
Georgen ob Tösens aus dem späten 15. Jahrhundert erhalten haben (Kat.-Nrr. 2 und 135). Die
gemalten Inschriftenfelder in St. Georgen beinhalten dabei im Gegensatz zur Stamser Weiheinschrift
neben der ausführlichen Reliquienaufzählung auch den Namen des ausführenden Malers,
Marx (Danauer) aus Innsbruck.
Eine große Anzahl von Inschriften an kirchlichen Bauten machen die Bauinschriften aus, die
sich äußerst zahlreich insbesondere aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts und aus dem 16.
Jahrhundert erhalten haben. Diese bestehen zumeist aus einer einfachen Bauzahl, werden jedoch
bisweilen mit der Nennung des Stifters oder der Stifterinitialen bzw. den Initialen des ausführenden
Malers versehen. Die erhaltenen und kopial überlieferten Bauinschriften finden sich vor allem
im Innenraum der Kirchen, wesentlich seltener an der Außenwand des Kirchenschiffs – ein Ungleichgewicht,
das sich auch unter Berücksichtigung der etwas häufigeren Bauinschriften auf
Türmen nicht ganz ausgleicht. Damit scheint in Tirol der Außenbau von Kirchen bei der Anbringung
von Bauinschriften eine untergeordnete Rolle gegenüber dem Innenraum gespielt zu
haben147. Der Großteil aller Bauinschriften wurde direkt auf den Putz gemalt; wesentlich seltener
verewigte man sie in Stein oder auf Holz, wie etwa 1596 an der Holzdecke der Nauderer Leonhardskapelle
(Kat.-Nr. 220). Blickt man auf die zeitliche Verteilung der insgesamt 18 Bauzahlen,
so stellt man einen gewissen Einbruch um die Mitte des 16. Jahrhunderts fest. Diese Zäsur lässt
sich damit erklären, dass nach dem spätgotischen Bauboom des 15. und frühen 16. Jahrhunderts
in der Zeit der frühen Konfessionalisierung nur wenige Kirchenbauten in Tirol entstanden oder
renoviert wurden; als dann mit dem Frühbarock und der Gegenreformation zu Ende des 16.
Jahrhunderts und vor allem im 17. Jahrhundert neuer Schwung in den Tiroler Kirchenbau kam,
nahmen auch die Bauinschriften wieder deutlich an Zahl zu. Worauf die Bauinschriften und vor
allem die Bauzahlen konkret hinweisen, lässt sich dabei nur aus dem jeweiligen Kontext erschließen:
Sie können sich sowohl auf die Erbauung des Gesamtgebäudes, eines Gebäudeteils, eine
Renovierung, als auch auf eine Ausmalung beziehen. Zur Vorsicht bei der Zuordnung mahnt ein
Beispiel aus der Rochuskapelle in Reutte: Die dort sichtbare Bauzahl 1526 kann sich kaum auf
die Erbauung der Kapelle beziehen, da diese überhaupt erst 1619 errichtet wurde. Vielleicht
handelt es sich hierbei also um eine Spolie aus einer Vorgängerkapelle (Kat.-Nr. 303).
Weit komplexer stellt sich jedoch die zweite Gruppe mit jenen Inschriften dar, die in direktem
Zusammenhang mit der Anbringung von Wandmalereien stehen, diese kommentieren oder ergänzen
und somit einen integralen Bestandteil von deren Ikonographie darstellen. Hierunter
fallen zunächst alle Tituli, wie etwa die Nennung des Hl. Daniel in der Imster Friedhofskapelle
und an der Außenwand der dortigen Pfarrkirche jeweils vom Ende des 15. Jahrhunderts (Kat.-Nrr.
26 und 36) oder bestimmte Teile der Wandmalereien in St. Georgen ob Tösens von 1482 und
1496 (etwa Kat.-Nr. 138f.).
Etwas aufwändiger sind bereits die in Spruchbändern eingeschlossenen Inschriften. Dabei kann
es sich durchaus auch um eine Art Titulus handeln, etwa in den Spruchbändern der Evangelistensymbole,
wie sie in mehreren Chorgewölben spätgotischer Kirchen und Kapellen im Oberland
vorkommen. Beispiele hierfür sind die Wallfahrtskirche von Serfaus mit Wandmalereien aus der
Zeit um 1360 (Kat.-Nr. 123), die Inschriften in der Stubener Pfarrkirche aus dem späten 15. Jahrhunderts
(Kat.-Nr. 146) oder in der Fernsteinkapelle vom Ende des 15. Jahrhunderts (Kat.-Nr.
65). In Prutz findet sich hingegen ein Apostelzyklus mit Teilen des Glaubensbekenntnisses von
1637 (Kat.-Nr. 259), dem man das ältere Apostelcredo in Pians aus der Zeit um 1420 zur Seite
stellen kann (Kat.-Nr. 125). Häufig sind auch Dialoge zwischen den handelnden Figuren in den
Spruchbändern präsent, so etwa zwischen Maria und dem Engel bei der Verkündigung (St.
Georgen ob Tösens; Kat.-Nr. 138) oder Maria und Elisabeth (Pfunds-Stuben; Kat.-Nr. 149). Zu
dieser Gruppe von Inschriften gehören auch die ältesten Inschriftenfragmente dieser Edition in
der Leonhardskapelle in Nauders (Kat.-Nr. 120).
Nicht immer, aber doch häufig werden auch Stifterinschriften mit Heiligenanrufungen in
Spruchbändern überliefert. Der älteste Fall solcher Stifterinschriften in Wandmalereien findet sich
in der Wallfahrtskirche in Serfaus aus dem 14. Jahrhundert, sowohl im Langhaus, wo der Stifter
neben einer Kreuzigungsszene ein Spruchband mit dem Text MISERERE MEI in den Händen
hält (Kat.-Nr. 121), als offenbar auch im Chor, wo sich die Inschriften jedoch nur mehr sehr
fragmentarisch erhalten haben (Kat.-Nr. 122). Eine Bauzahl gemeinsam mit einer solchen Stifterinschrift
findet sich am Westportal der Pfarrkirche von Landeck aus dem Jahr 1506; hier haben
wir es allerdings nicht mit einer Heiligenanrufung, sondern nur mit den Namen des Stifterpaares
zu tun (Kat.-Nr. 154). Im Formular der Stifterinschriften scheint – wie hier in Landeck – die
klassische Heiligenanrufung im 16. Jahrhundert außer Mode zu kommen. Dagegen kann man
durchaus den Segenswunsch für die Seelen der Stifter vorfinden (Kat.-Nr. 165†), und auch eine
ausführlichere Vorstellung der Stifter über die reine Nennung ihrer Namen hinaus kommt im 17.
Jahrhundert zunehmend in Gebrauch (Kat.-Nrr. 321).
Wie bereits im Kapitel über die Inschriften auf kirchlichen Gegenständen angedeutet148, finden
sich auch in den Wandmalereien immer wieder Umschriften, die den Inhalt der Ikonographie
genauer charakterisieren; ein Beispiel sind die Worte Christi am Ölberg in der entsprechenden
Wandmalerei in der Stubener Pfarrkirche (Kat.-Nr. 148). Solche Umschriften treten jedoch nicht
nur innerhalb der Wandmalereien selbst auf (und hier dann zumeist wie in Stuben in einem
Spruchband), sondern können auch in einem Rahmen neben oder unter dem Bild auftauchen.
Zur Illustration seien hier die Christophorus-Fresken an der Außenseite der Kirchengebäude gesondert
genannt. Ein solcher monumentaler Christophorus aus dem 14. Jahrhundert findet sich
an der Außenwand der Pfarrkirche in Umhausen; in einem die Wandmalerei umschließenden
Bord findet sich hier auch eine Inschrift, die auf die im Mittelalter verbreitete Legende Bezug
nimmt, der Anblick des Heiligen schütze vor plötzlichem Tod (Kat.-Nr. 9). Dass die Christophorus-
Darstellungen im Oberland vor allem auf eine aufgrund der Gefahren des Reisens über die
Alpenpässe gesteigerte Frömmigkeit zurückzuführen seien, wie jüngst behauptet worden ist149,
stellt nicht zuletzt das relativ frühe Haiminger Beispiel in Frage, liegt Haiming doch nicht an der
klassischen Nord-Süd-Route durchs Tiroler Oberland. Im Gegenteil, bei der Verehrung des Hl.
Christophorus handelt es sich um ein geographisch weit verbreitetes Phänomen des Spätmittelalters
und der frühen Neuzeit150, wie nicht zuletzt auch vergleichbare Stücke in der Druckgraphik
belegen, die eine Verehrung des Heiligen zum Schutz vor plötzlichem Tod auch im privaten
Rahmen ermöglichten151.
Häufig finden sich Kombinationen der bisher genannten Typen, also von Tituli, Spruchbändern
und Umschriften, so etwa in den umfangreichen, meist spätmittelalterlichen Wandmalereizyklen
wie in Pians (Kat.-Nr. 125) oder den frühbarocken Malereien von St. Vigil in Obsaurs
(Kat.-Nrr. 169†, 213, 226, 241 und 251), aber auch in der schon mehrfach genannten Pfarrkirche
von Stuben. Hier lässt sich im epigraphischen Bestand auch eine Besonderheit greifen, die für die
ausführenden Künstler des Zyklus’ rund um den Maler Martin Enzelsberger charakteristisch erscheint:
Die Tituli sind hier nicht in Spruchbändern oder Architekturelementen, sondern im
Heiligenschein der Figuren versteckt (vgl. etwa Kat.-Nr. 148f.). Die Darstellung von Engeln mit
Spruchbändern, wie sie auch in den Tafelbildern (etwa am „Defensorium“, Kat.-Nr. 17, oder dem
Annenaltar aus dem Ferdinandeum, Kat.-Nr. 153) vorkommen, finden sich auch in den Chormalereien
von Pians (Kat.-Nr. 125); dabei wird ein beliebtes Motiv spätmittelalterlicher Ikonographie
aufgegriffen152.
Häufiger greifbar, leider aber nur mehr selten original (und dann zumeist fragmentarisch)
erhalten sind auch Wandmalereien mit Stifter- bzw. Beterreihen, die die Namen der Personen
über ihrem Kopf aufweisen. Solche Beterreihen lassen sich kopial noch für Oswald von Schrofenstein,
seine Frau Praxedis von Wolkenstein und ihre Kinder an der Landecker (Kat.-Nr. 156†)
sowie für Walter Hendl an der Imster Pfarrkirche (Kat.-Nr. 32) greifen. Zumindest fragmentarisch
haben sich solche Beterreihen an den Wänden von St. Vigil in Obsaurs erhalten (Kat.-Nrr. 212f.
und 225).
6.4.3. Fassadendekorationen und Bauinschriften an Profangebäuden
In vielerlei Hinsicht entsprechen auch die Bauinschriften an profanen, öffentlichen wie privaten
Gebäuden dem Befund in Kirchen; ihr häufiges Auftreten im Bearbeitungsgebiet und auch ihre
durchaus vorhandenen Eigenheiten lassen es dennoch sinnvoll erscheinen, ihnen ein eigenes
Unterkapitel der Einleitung zu widmen. Gerade die Inschriften im Kontext der reichen Fassadenmalereien
besonders prunkvoll gestalteter Häuser im Oberland sind hier als Spezifikum der Tiroler
Epigraphik zu nennen153.
Zur großen Gruppe der kurzen Bauinschriften zählen auch im weltlichen Bereich vor allem
die Bauzahlen, die manchmal mit einem Spruch oder einer Wortdevise versehen werden; im 17.
Jahrhundert werden sie mitunter mit Initialen und/oder dem Jesusmonogramm kombiniert.
Dabei handelt es sich zumeist um gemalte Inschriften, doch wurden sie ähnlich wie im kirchlichen
Bereich vereinzelt auch eingemeißelt, um dann zumeist mit Farbe nachgezogen zu werden. Man
brachte die Bauinschriften gerne an der Außenseite von Gebäuden wie etwa Wohnhäusern oder
Scheunen an, wobei der Platz über einem Fenster sich offenbar der größten Beliebtheit erfreute.
In geschnitzter Form treten Bauinschriften aus dem 17. Jahrhundert vor allem in Dachbalken bzw.
an den Holzgiebeln von Oberländer Häusern auf, wobei zumeist eine Jahreszahl mit dem Namen
der Besitzer das knappe Formular bildet (Kat.-Nrr. 76, 83 und 91). Zu den beliebtesten Orten für
einfache Bauzahlen im Außenbereich gehören seit dem 16. Jahrhundert auch Hausdurchfahrten,
Stadt- und Burgtore (Kat.-Nrr. 305†, 202 und 206). Eine längere Bauinschrift an einem solchen
Ort weist die marmorne Inschriftentafel an der Ehrenberger Klause von Erzherzog Maximilian
III. von 1609 auf (Kat.-Nr. 320). Im Inneren von Gebäuden trifft man vor allem in den von allen
Hausbewohnern und -besuchern gleichermaßen genutzten Teilen des Baus auf Bauinschriften,
etwa im Balken über einem Stiegenaufgang oder einer Gangwand (Kat.-Nrr. 168, 205† und 74†),
aber auch wie im Falle der Burg Bideneck in Fließ im Rahmen der repräsentativen Ausstattung
einer Stube (Kat.-Nr. 175†).
Bei einem Blick auf die zeitliche Verteilung dieser Bauinschriften fällt das deutlich frühere
Auftreten als im kirchlichen Bereich auf: Während in letzterem Zusammenhang erst in den
letzten beiden Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts vermehrt Bauzahlen auftreten, lassen sich mit den
Bauinschriften von Burg Berneck (1437; Kat.-Nr. 128f.) sowie eines Hauses in Fiss (1459; Kat.-Nr.
133) frühere profane Beispiele anführen. Auch der Einbruch in der Mitte des 16. Jahrhunderts
fällt hier weniger stark aus als im kirchlichen Bereich; allerdings gibt es auch hier eine sogar noch
deutlichere Zunahme im 17. Jahrhundert. Deutet dieser Befund auf die hohe Kontinuität der
Bautätigkeit im Oberland in den letzten hier berücksichtigten Jahrhunderten hin, die sogar jene
der oft umgestalteten Kirchen übertrifft, so zeigt gerade die Arbeit an diesem Inschriftenband
zugleich auch den rasanten Verfall dieses epigraphischen Erbes in den letzten, mit dem ökonomischen
Aufschwung durch den Tourismus verbundenen Jahrzehnten. Wesentlich häufiger als im
kirchlichen Bereich lässt sich hier eine durchaus rezente Zerstörung nachweisen, und oftmals
gingen gerade kurze Bauinschriften ohne größeren künstlerischen Anspruch innerhalb der letzten
dreißig Jahre bei Umbauten verloren. Die Unbekümmertheit im Umgang mit den originalen
Bauzahlen vor allem des 17. Jahrhunderts steht dabei in Gegensatz zu dem Bemühen, seinem
eigenen Wohnhaus gerade durch die Anbringung deutlich vordatierter Bauzahlen ein möglichst
hohes Alter zu bescheinigen154.
Umfangreichere Bauinschriften begegnen uns im weltlichen Bereich bereits 1437 auf Burg
Berneck in Kauns; sie nennen nicht nur den Bauherren Hans Wilhelm von Mülinen, sondern
auch den (wohl die Bauabwicklung planenden) Baumeister Peter Koffel (Kat.-Nrr. 128f.). Ausführliche
Inschriften finden sich ansonsten im Tiroler Oberland vor allem im Kontext der Fassadenmalereien
des späten 16. und 17. Jahrhunderts, und wiederum belegt dieser Umstand die im
Vergleich relativ unbedeutende Stellung des Adels für die Epigraphik des Oberlands, da es sich
hierbei vor allem um Gasthöfe und reiche Bauernhöfe handelt. Üblicherweise findet sich in
diesen Inschriften die Nennung des Bauherrn, von dessen Stellung, Beruf und/oder Ämtern, der
Name seiner Frau, die Art der Veränderungen – etwa einer Renovierung –, sowie deren Datierung.
In der Regel begleitet die Bauinschrift eine Fassadenmalerei mit Wappen und biblischen
Szenen, die mit den entsprechenden Bibelzitaten ergänzt werden. Solche Fassadenmalereien finden
sich am Gasthof „Zum Stern“ in Oetz (Kat.-Nr. 60), am Stecherhaus in Oetz (Kat.-Nr. 75), in
Wenns am sogenannten Platzhaus (Kat.-Nr. 61), am Grassmayrhaus in Habichen (Kat.-Nr. 95),
am Stockerhaus in Ladis (Kat.-Nr. 252), am ehemaligen Gasthof Rose bzw. dem heutigen Gemeindehaus
in Ladis (Kat.-Nr. 216f.), am Haus Niederhof Nr. 119 in Kappl (Kat.-Nr. 250) und
am Hotel Schwarzer Adler in St. Anton am Arlberg (Kat.-Nr. 197†). Auch einfachere Fassadenmalereien
lassen sich mitunter greifen, so etwa die Richterwappen mit Namensnennungen und
Datierung am Haus Maisengasse 2 in Landeck (Kat.-Nr. 193). Bei einem Blick auf die geographische
Verteilung der Fassadenmalereien fällt auf, dass diese Beispiele allesamt aus den Bezirken
Imst und Landeck stammen; im Bezirk Reutte finden sich keine aufwändigen Fassadenmalereien
aus dem hier untersuchten Zeitraum, wenngleich sich spätere, barocke Beispiele anführen ließen155.
Im Innenraum sind solche aufwändigen Malereien, wie sie die Fassaden reicher Oberländer
Häuser zieren, nur selten zu finden, was deren Funktion für die Kommunikation nach außen
belegt. So verwunderte es auch wenig, wenn der größte Zyklus solcher Malereien für den Innenraum
gerade im Gang eines Hauses zu finden ist und sich somit ebenfalls direkt an den Besucher
des Hauses wendet: Es handelt sich dabei um den Wappenzyklus im Richterhaus von Stuben aus
der Mitte des 17. Jahrhunderts (Kat.-Nr. 273).
6.4.4. Der Nexus litterarum als Künstlermonogramm in den Fassadenmalereien des Oberlands als Künstlermonogramm in den Fassadenmalereien des Oberlands
Ein bislang unbeachtetes epigraphisches Detail ließ sich im Rahmen dieser Edition an mehreren
Malereien des späten 16. und frühen 17. Jahrhunderts nachweisen. Es handelt sich um einen
Nexus litterarum der Buchstaben A͜ F (der Sporn am unteren Schaftende von F mitunter balkenartig
vergröbert, so dass der Eindruck eines A͜E-Nexus entstehen kann), der sich sowohl an
Fassadenmalereien in Ladis von 1590, in den Langhausmalereien von 1598 in der Pianser Margarethenkapelle,
als auch am Grassmayrhaus 1633 jeweils neben einer Jahreszahl finden ließ (Kat.-
Nrr. 216, 223 und 95). Bislang wurden vor allem die Fassadenmalereien des Grassmayrhauses in
Habichen dem Maler Alexander Fischer zugeschrieben, dem mehrere Kunsthistoriker auch die
Ausführung der Fassadenmalereien am Gasthof „Zum Stern“ in Oetz (Kat.-Nr. 60), sowie die
jüngeren Malereien am sogenannten Platzhaus in Wenns (Kat.-Nr. 61) zuschreiben. Die Restauratorin
Hemma Kundratitz schreibt zudem auch die Malereien im Chor der Vigilskirche in
Obsaurs diesem Maler zu (Kat.-Nr. 213). Der epigraphische Befund sichert und erweitert nun die
Zuschreibung mehrerer Fassadendekorationen an Fischer, denn die Ligatur A͜ F in Habichen stützt
die Autorschaft dieses Künstlers: Es handelt sich jedenfalls um seine Initialen, liest man den
Nexus auch (wie bisweilen vorgeschlagen wurde) als  für Alexander oder als für Alexander oder als  für eine
Kontraktion aus Vor- und Nachnamen. Da dieselbe Buchstabenkombination auch in Ladis vorkommt
(zusammen mit der Signatur CT, also wohl den Initialen eines Malers, mit dem Alexander
Fischer in diesem, seinem frühesten belegbaren Werk offenbar noch als Geselle zusammenarbeitete),
ist wohl auch diese Malerei Fischer und seinem Kollegen CT zuzuschreiben. Als erstes
eigenständiges Werk dürften nach dem erneuten Beleg des Nexus A͜ F (diesmal ohne weitere Initialen)
die Malereien im Langhaus der Margarethenkirche von Pians aus dem Jahr 1598 gelten. für eine
Kontraktion aus Vor- und Nachnamen. Da dieselbe Buchstabenkombination auch in Ladis vorkommt
(zusammen mit der Signatur CT, also wohl den Initialen eines Malers, mit dem Alexander
Fischer in diesem, seinem frühesten belegbaren Werk offenbar noch als Geselle zusammenarbeitete),
ist wohl auch diese Malerei Fischer und seinem Kollegen CT zuzuschreiben. Als erstes
eigenständiges Werk dürften nach dem erneuten Beleg des Nexus A͜ F (diesmal ohne weitere Initialen)
die Malereien im Langhaus der Margarethenkirche von Pians aus dem Jahr 1598 gelten.
6.5. Graffiti
Eine oftmals in ihrer Aussagekraft weit unterschätzte Inschriftengruppe stellen die zumeist mit
Rötelstift an die Wand geschriebenen oder einfach in den Putz oder ins Holz geritzten Graffiti
dar, die sich im gesamten Tiroler Raum seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts in großer
Zahl nachweisen lassen, und die auch in der vorliegenden Edition rund ein Zehntel der Katalognummern
ausmachen156. Trotz ihres mitunter hohen Alters und bisweilen nicht geringen Quellenwertes
werden sie in der kunsthistorischen Forschung zumeist ignoriert oder gar beklagt157. Doch
handelt es sich bei dieser Inschriftengattung wirklich um eine Form von möglichst heimlich zu
praktizierendem Vandalismus? Daran lässt im vorliegenden Bestand etwa der Befund der Graffiti
in der Glocke der Stamser Stiftskirche zweifeln: Die sich verewigenden Schreiber des 16. Jahrhunderts
ließen sich hier als Angehörige des Konvents identifizieren (Kat.-Nr. 54).
Spätestens die Untersuchungen zur Altarplatte in der Stiftskirche St. Peter und Paul in Reichenau-
Niederzell mit ihren zahlreichen Ritz- und Tintenzeichnungen des 10. und 11. Jahrhunderts,
die von Pilgern wohl dazu angebracht wurden, „auf diese Weise ihrer auf den Augenblick
beschränkten körperlichen Anwesenheit in der als bergend und schützend verstandenen
Gegenwart des seliggesprochenen und hoch verehrten Stifters und Kirchengründers [gemeint ist
der Selige Bischof Egno von Verona] zeitlich Dauer zu verleihen“158, haben die frömmigkeitsgeschichtliche
Qualität mittelalterlicher Graffiti deutlich gemacht. Unter den in solchen epigraphischen
Zeugnissen greifbaren Reisenden und Pilgern vor allem des Spätmittelalters lassen sich
oftmals auch Tiroler Adelige nachweisen, wie dies etwa Detlev Kraack für die Hohenecker und
Frundsberger im Heiligen Land gelungen ist159. Jüngere Studien zeigen zudem die Bedeutung der
Graffiti-Forschung gerade für den Tiroler Raum, konnten doch etwa für die Stadt Hall in Tirol
durch eine eingehende Untersuchung dortiger Graffiti wesentliche Aussagen zu Entstehungszeit
und Übermalung eines Jüngsten Gerichts160, aber auch zur Nutzung der Empore in der Pfarrkirche
gemacht werden161. Dass solche spontane Schriftäußerungen keineswegs den Ausfluss
vandalistischer Betätigung darstellen, zeigt auch eine genauere Untersuchung der Graffiti auf der
Ruine der Kronburg in Zams. Die ältesten Rötelinschriften wurden bereits lange vor der Zeit
angefertigt, als man die Burg dem Verfall überließ; ursprünglich handelte es sich also in der Wahrnehmung
der frühneuzeitlichen Schreiber zweifellos nicht um einen Akt des Vandalismus an
einem ohnedies bereits verfallenden Gebäude (Kat.-Nrr. 237 und 240).
In den vorwiegend in Kirchenräumen erhaltenen Graffiti des Tiroler Oberlands lassen sich vor
allem die Durchreisenden der frühen Neuzeit anhand ihrer epigraphischen Spuren greifen.
Manchmal gelingt es dabei, nicht nur ihre Herkunft, sondern auch das Ziel ihrer Reise genauer
zu benennen, wie dies etwa bei der französischen Pilgergruppe aus Cambrai der Fall ist, die sich
auf dem Weg nach Rom in der Kapelle am Fernstein verewigte (Kat.-Nr. 51), und auch bei den
Schreibern der Graffiti in der Vigilskirche in Obsaurs handelt es sich vorrangig um Pilger162.
Bemerkenswert ist dabei, dass einige von ihnen offensichtlich bewusst den Umweg über die Vigilskirche
machten, die gar nicht an der direkten Nord-Süd-Route über den Oberen Weg lag. Da
sich hier ebenfalls Pilgersymbole finden, die eher an eine überregionale Wallfahrt denken lassen,
kann man diesen Umstand nicht ohne weiteres durch eine Klassifizierung der Kapelle als lokales
Pilgerziel erklären. Der im Tiroler Oberland gut nachweisbare Brauch, sich auf einer Pilgerreise
nach Rom oder ins Heilige Land zu verewigen, passt auch zum Befund der Tiroler Epigraphik
insgesamt, lassen sich in diesem Durchzugsland zwischen Nord und Süd doch zahlreiche Reisende
fassen. So hinterließ etwa der Student Konrad von Thüngen auf seinem Heimweg von Padua
epigraphische Spuren im Gasthaus „Zum Hirschen“ in Innsbruck; ähnliche Zeugnisse sollen sich
noch im 17. Jahrhundert in einer Brixner Herberge befunden haben163. Am Arlberg verewigte
sich der Münchner Patrizier Balthasar Pötschner mit einer Votivtafel, wie er selbst berichtet: „Item
zu sand Cristof auf dem Adlperg hab ich ein tafel lassen machen, daran sandt Cristof und meine
kind darbey“164. Leider ließ sich von der Tafel keine kopiale Überlieferung mehr ausmachen. Ein
kurioser Beleg für die Reiselust eines vermutlich aus Tirol stammenden Schreibers stellt der Namenszug
des Linhart von Mauern dar, der sich nicht nur in der Apsis der Stamser Stiftskirche
erhalten hat (Kat.-Nr. 38), sondern der sich auch in der Haller Salvatorkirche findet. Zumindest
im letzteren Falle lässt sich dabei sogar nachweisen, dass es Linhart von Mauern nicht nur um die
Verewigung am Heiligen Ort – auch hier ist es der östlichste Punkt des Chores –, sondern nicht
zuletzt auch um die möglichst gute Sichtbarkeit auf der darunterliegenden Wandmalerei ging,
denn er setzte hier zweimal für seinen Namenszug an verschiedenen Stellen an und wählte schließlich
gezielt den helleren Untergrund einer wesentlich besser sichtbaren Stelle165.
Die erhaltenen Graffiti des Tiroler Oberlands mit ihrer Nennung von Namen oder Namensinitialen,
sowie einer Datierung lassen sich sozialgeschichtlich mit Gewinn auswerten166 und sind
oftmals besonders für die Bauforschung und die Kunstgeschichte wertvolle Datierungshilfen; Beispiele
hierfür sind etwa die Graffiti in der Rochuskapelle Biberwier, die eine Datierung für die
Fertigstellung des Turmes liefern (Kat.-Nr. 329) oder die Inschrift auf Burg Berneck mit ihrem
Bezug zur Erbauung der Kapelle (Kat.-Nr. 228).
6.6. Glasmalereien
Aus dem Tiroler Oberland haben sich zahlreiche Bildfenster mit Inschriften erhalten, wenngleich
ein großer Teil dieser Scheiben sich heute nicht mehr vor Ort, sondern in den Beständen des
Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum befindet. Mag der Anteil am Katalog mit nur etwa 5%
auch gering sein, so zeigt bereits der Umstand, dass es sich bei der mutmaßlich ältesten nachweisbaren
Inschrift des Bezirks Imst um ein Bildfenster aus der Heilig-Blut-Kapelle in der
Stamser Stiftskirche von 1279 (?) handelt (Kat.-Nr. 1†), wie bedeutend dieser Bestand im Rahmen
der Tiroler Epigraphik ist. Gerade diese Scheibe, die nach den Quellen „durch die mangelnde
Sorgfalt der Maurer“ zerstört wurde167, macht deutlich, dass bei den Glasfenstern nicht erst – wie
bei den Glocken – die Weltkriege größere Lücken in den heutigen Bestand rissen, sondern dass
Fenster stets stärker der Zerstörung im Zuge von Umbauten oder anderen Ereignissen ausgesetzt
waren. Umgekehrt trugen aber auch die Weltkriege zur Dezimierung des Bestands bei; eine
glückliche Ausnahme stellen dabei die qualitativ besonders hochwertigen zwei Fensterpaare in
der Pfarrkirche von Haiming dar, die nur durch den Einsatz des Denkmalamtes im Krieg abgenommen
wurden und so noch erhalten sind (Kat.-Nrr. 45 und 50). Bei diesen Wappenscheiben
von vier Mitgliedern der Familie Frundsberg handelt es sich um die einzigen in situ erhaltenen
Bildfenster des Tiroler Oberlands; der restliche Bestand befindet sich heute im Tiroler Landesmuseum
Ferdinandeum. Dabei handelt es sich um zwei Wappenscheiben des Veit von Wehingen,
sowie drei Rundscheiben mit alttestamentlichen Szenen aus der Ruine Sigmundsried (Kat.-Nrr.
172, 176 und 185–187), vier Wappenscheiben von Hans Ott von Achterdingen, Hans Franz von
Wehingen, sowie deren Frauen Maria von Lichtenau und Magdalena Schurf aus der Pfarrkirche
St. Leonhard in Ried (Kat.-Nrr. 178f. und 188f.) und zwei Wappenscheiben des Hans Jakob
Gräfinger sowie seiner Frau Ursula Kripp (Kat.-Nr. 234f.), sowie um eine rechteckige Zunftscheibe,
die vermutlich aus dem Gebiet des Gerichts Ehrenberg stammt und mehrere Zunftbrüder
nennt (Kat.-Nr. 316). Eine Besonderheit stellt ein im Stiftsmuseum Stams erhaltenes, bemaltes
Glaskästchen von 1557 mit späteren Ergänzungen dar (Kat.-Nr. 55). Bis auf die oben genannte,
kopial überlieferte Stifterscheibe aus der Heilig-Blut-Kapelle in Stams stammen alle bekannten,
mit Inschriften versehenen Bildfenster des Tiroler Oberlands aus dem 16. und frühen 17. Jahrhundert.
Im grundsätzlichen Aufbau ähneln einander insbesondere die Wappenscheiben stark. So findet
sich hier in der Mitte der rechteckigen oder runden Scheibe das Wappen der betreffenden Person;
im Falle einer runden Scheibe wurde das Inschriftenband üblicherweise am Rand der Scheibe
angebracht, während bei einer rechteckigen Form zumeist ein querrechteckiges Inschriftenfeld
im unteren Teil eine zeilenweise Beschriftung aufweist. Die Inschrift nennt dabei üblicherweise
den Namen des Stifters samt einer Aufzählung seiner Ämter sowie die Jahreszahl. Die Scheiben
wurden zumeist paarweise angefertigt, wobei das Formular für die Inschrift auf der Scheibe einer
Ehefrau die Auflistung der Ämter des Mannes durch die Nennung ihres Mädchennamens ersetzt.
Bei den verwendeten Schriftarten fällt die gegenüber den in Stein gemeißelten Grabinschriften
relative Modernität der auf Glas gemalten Inschriften auf168.
6.7. Nicht-liturgisches Inventar und Mobiliar
Eine kleinere Gruppe von Inschriften insbesondere des 17. Jahrhunderts findet sich auf wandfester
Ausstattung wie Türen und Mobiliar wie Truhen oder Betten. Ihre Inschriften geben zumeist
eine Jahreszahl sowie die Initialen oder den Namen des Besitzers an. Diese Mitteilungsinhalte
sind etwa bezeichnend für die typischen Zirbenholztruhen des Oberlandes; sie stammen
– soweit sich ihre Herkunft überhaupt noch klären lässt169 – größtenteils aus dem Ötztal (Kat.-
Nrr. 56 und 67). Ähnlich verhält es sich mit den Inschriften auf Portalverkleidungen und Türblättern
(Kat.-Nrr. 69 und 83) oder auf Bettgestellen aus dem 17. Jahrhundert (Kat.-Nr. 276). Hier
tritt mit dem Jesusmonogramm auch eine apotropäische Bedeutung zur reinen Besitzernennung
hinzu.
Nur durch ihre sekundären Standorte im 18. Jahrhundert sind zwei bemalte Tafeln des frühen
17. Jahrhunderts, ursprünglich wohl hölzerne Epitaphien mit Inschriften auf mehrere Angehörige
der Familie Hoheneck (Kat.-Nrr. 317†f.), als Bestandteil der mobilen Ausstattung eines Vilser
Wirtshauses anzusprechen.
Werner Köfler, Romedio Schmitz-Esser
Die Deutschen Inschriften
Herausgegeben von den Akademien der Wissenschaften in
Düsseldorf · Göttingen · Heidelberg · Leipzig · Mainz · München
und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien
82. Band, Wiener Reihe 7. Band
Die Inschriften des Bundeslandes Tirol - Teil 1
Die Inschriften der Politischen Bezirke Imst, Landeck und Reutte
 Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
Austrian Academy of Sciences Press
|
|
Schlagworte
Die Inschriften des Bundeslandes Tirol • Politische Bezirke Imst, Landeck und Reutte • Die Inschriftenträger • Grabdenkmäler und Inschriften des Totengedenkens • Typologie der Grabdenkmäler • Die Inschriften des Totengedenkens und ihr Formular • Glocken • Formular der Glockeninschriften • Glockengießer • Fehler bei der Ausführung gegossener Inschriften • Kirchliche Ausstattungsgegenstände und liturgische Geräte • Taufsteine • Altäre • Inschriften an Gebäuden • Überlieferungsproblematik der (gemalten) Gebäudeinschriften • Inschriften in und an Kirchen • Fassadendekorationen und Bauinschriften an Profangebäuden • Der Nexus litterarumals Künstlermonogramm in den Fassadenmalereien des Oberlands • Graffiti • Glasmalereien • Nicht-liturgisches Inventar und Mobiliar •
|


Die Inschriften der Politischen Bezirke Imst, Landeck und Reutte, ges. u. bearb. v. Werner Köfler und Romedio Schmitz-Esser (Die Deutschen Inschriften 82. Band, Wiener Reihe 7. Band, Teil 1) Wien 2013, 6. Die Inschriftenträger,
URL: hw.oeaw.ac.at/inschriften/tirol-1/tirol-1-traeger.xml