| |
Die Inschriften des Bundeslandes Niederösterreich
Politischer Bezirk Krems
5. Die Schriftformen149
5.1. Romanische und Gotische Majuskel (vgl. die abgebildeten Nachzeichnungen)
Belege Romanischer Majuskel sind im vorliegenden Material dünn gesät und weisen jeweils beträchtliche
zeitliche Distanz zueinander auf, Umstände, die den Entwurf einer überblicksweisen
Schriftentwicklung kaum erlauben. Zudem sind gerade die ältesten Inschriften hinsichtlich der
den jeweils unterschiedlichen Medien entsprechenden Ausführungstechnik kaum vergleichbar.
Die mittels mäßig breitem Pinsel in rotbrauner Farbe aufgemalte Weiheinschrift der ehemaligen
Mauterner Margaretenkapelle von 1078 (Kat.-Nr. 1) weist einen rein kapitalen Buchstabenkanon
auf, dessen monumentalen Eindruck ein leichtes Schwanken des Duktus, teils unregelmäßige
Buchstabenproportionen und eine stellenweise weniger sorgfältige Spationierung etwas
beeinträchtigen. Die von wenigen breiten Einzelformen und den fetten Schattenlinien in ihrem
Gesamteindruck bestimmte Inschrift weist eine hohe Zahl an Nexus litterarum auf. Freie Schaft und
Bogenenden werden entweder keil- oder spachtelförmig ausgeführt bzw. an Ober- und
Unterlinie stumpf abgeschnitten und mit oft feinen, aber breiten Deck- und Abschlußstrichen
versehen.
Die geringen Buchstabenreste der Namensbeischrift zu einer Wandmalerei aus dem zweiten
Viertel des 13. Jahrhunderts (Kat.-Nr. 2) zeigen trotz überwiegend einheitlich fetter Striche Ansätze
zu einer Differenzierung: unziales E wird mit kräftiger Bogeninnenschwellung versehen und
mit leicht durchgebogenem Haarstrich geschlossen, die durchgebogene Cauda des offenbar mit A
in Nexus litterarum befindlichen R kräftig geschwellt. A ist trapezförmig und weist breite Deck und
Basisstriche auf, G zeigt eingerollte Form, T mit breitem Basisstrich hat stark ausgezogene
serifenartige Balkenenden.
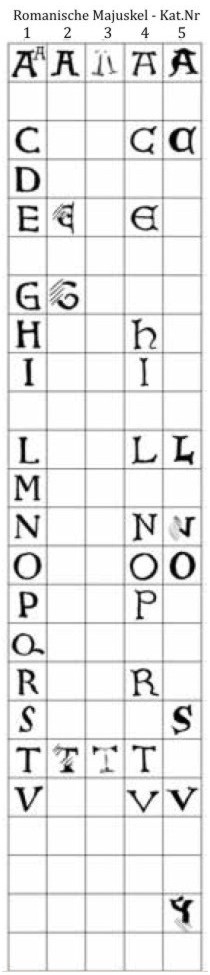
A und T auf einer Scheibenkreuzgrabplatte der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts (Kat.-Nr. 3)
sind ziemlich linear ausgeführt, besitzen aber breite, leicht dreieckig ausgeführte Deck- und Basisstriche
bzw. Sporen an den Balkenenden.
Die Grabinschrift des Konrad von Praitenloh aus dem letzten Drittel des 13. Jahrhunderts
(Kat.-Nr. 4) ist vom kapitalen Kanon der Mauterner Weiheinschrift bereits merklich entfernt und
zeigt in der Schriftgestaltung für die Entwicklung hin zur Gotischen Majuskel trotz an sich noch
sehr linearer Bildung der Buchstaben produktive Merkmale wie etwa eine durch kräftige dreieckige
Sporen bzw. ansatzweise gegabelte Schaftenden angedeutete optische Einschnürung der
Schaftmitten. Dem konservativen trapezförmigen A mit beiderseits weit überstehenden Deckstrich,
den kapitalen N, T und V stehen das mittels geradem Strich geschlossene unziale E mit
angedeuteter Bogenschwellung (diese auch an P zu beobachten) und unziales H mit stark geschwungenem
und leicht einwärts gekrümmten Bogen sowie C mit beginnender Schließung der
Bogenlinie durch weit ausgezogene Sporen gegenüber.
Der als Beischrift zu einer Wandmalerei desselben Zeitraums ausgeführte Heiligenname (Kat.-Nr. 5)
bedeutet einen weiteren Entwicklungsschritt, den schwungvoller Auftrag und ausgeprägte
Flächigkeit des Pinselstrichs begünstigen. Fast alle Buchstaben zeigen nun kräftige Bogenschwellungen
und Schaftverstärkungen, freie Schaft- und Bogenenden werden mit leicht durchgebogenen,
breiten Haarstrichen besetzt, nur S weist kräftige dreieckige Serifen auf. C ist mit leicht
durchgebogenem Haarstrich geschlossen, der Haarstrich am Balken von L zieht dagegen noch
nicht gegen die Buchstabenmitte. A erscheint hier erstmals in pseudounzialer Form mit mächtiger
Bogenschwellung des linken Schrägschafts und zeigt einen mit Bogenschwellung versehenen
beidseitig überstehenden Deckbalken.
Der Schrifttyp der aufgemalten Evangelistennamen auf den
Schlußsteinen im Langhaus der ehemaligen Imbacher Klosterkirche
(Ende 13. Jahrhundert, Kat.-Nr. 6) ist erstmals als Gotische
Majuskel anzusprechen. Alle Buchstaben besitzen durchwegs
relativ fette Bogenschwellungen, A begegnet in pseudounzialer
Ausprägung mit annähernd senkrecht gestelltem linken
Schrägschaft. Während unziales M links geschlossen ist, weist S
zwar fette und andeutungsweise gegabelte Sporen, jedoch keine
Tendenz zur Schließung der Bögen auf. Die wohl ebenfalls an
das Jahrhundertende zu setzende, mit breitem Pinsel rasch ausgeführte
Namensinschrift eines Priesters Johannes (Kat.-Nr. 7)
ist wenig stilisiert und in manchen Einzelformen recht konservativ,
aber aufgrund der Doppelformen für A und des ersten
Belegs für unziales D bemerkenswert.
Eine vermutlich um 1300 ausgeführte Grabinschrift in Stein
(Kat.-Nr. 8) zeigt sich dagegen in der überwiegend linearen
Ausführung noch eher den Gestaltungsprinzipien und mit den
fast ausschließlich kapitalen Formen dem Kanon der späten
Romanischen Majuskel von Kat.-Nr. 4 verhaftet. Ein schriftgestalterisches
Detail bei R unterstreicht angesichts niederösterreichischen
Vergleichsmaterials ebenfalls eher konservative Tendenzen.
Für die weitere Entwicklung der Gotischen Majuskel in der
ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts ist an der Mehrzahl des
Materials die Verschiebung der Buchstabenproportionen von
überwiegend eher quadratischen hin zu tendenziell hochrechteckigen
Grundformen einschreibbaren Buchstaben zu konstatieren.
Bogenschwellungen werden bei häufig gerader Innenkontur
verstärkt und die Schließung von offenen Buchstabenbestandteilen
mit zunächst meist feinen Haarstrichen oder durch Verlängerung
und Einrollen von freien Bogenenden fortgesetzt, besonders
oft findet sich so etwa rundes, rechts fast vollständig
geschlossenes T. Regelmäßig werden variantenreiche Doppelformen
(„runde“ bzw. unziale und „eckige“ bzw. kapitale Ausprägungen)
mehrerer Buchstaben eingesetzt. Vor allem, aber nicht
nur bei gemalten Inschriften äußert sich das Bemühen um dekorative
Zierelemente mitunter in der Ausführung kräftiger (Halb-)Nodi in halber
Höhe des Schriftbands bzw. von Zierpunkten an
den Scheiteln der Bogeninnenkontur (vgl. etwa Kat.-Nr. 14 und
22) oder im Einstellen von senkrechten bzw. die Bogenlinie
begleitenden Haarstrichen in den Buchstabenbinnenraum. Freie
Schaft-, Balken- und Bogenenden werden keilförmig verbreitert
oder mit Dreiecken versehen, vereinzelt auch ansatzweise gegabelt,
bzw. als Haarstriche ausgeführt und am Ende tropfenförmig
verbreitert. Überstehende feine Schlußstriche (etwa an C und E)
werden gegen die Jahrhundertmitte zu oft eingerollt, teilweise
auch mit kleinen angesetzten Dreiecken versehen. Nach der Mitte
des 14. Jahrhunderts werden keine neuen Wege der Schriftgestaltung
in Gotischer Majuskel mehr beschritten. Zwei offenbar
aus derselben Werkstatt stammende Grabplatten (Kat.-Nr. 27
und 28) zeigen eine charakteristische spitze oder dreieckige Außenkontur
der Bogenschwellung (v. a. an C und E).
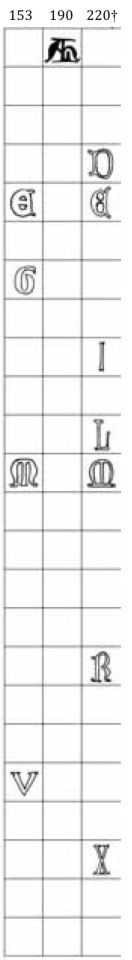
Der Übergang zur Gotischen Minuskel als alleiniger Schrift
für die Haupttexte eines Inschriftenträgers erfolgt übergangslos
um 1370/80. An der Schwelle des Umbruchs stehen die Grabplatten
des Priesters Engelhard von 1363 und des Göttweiger
Abtes Ulrich Totzenbacher von 1370 (Kat.-Nr. 27 und 28), bei
denen einerseits innerhalb der Umschrift in Gotischer Majuskel
eine wenig auffällige verkleinert hochgestellte gekürzte Kasusendung im
Rahmen der Jahresangabe in Gotischer Minuskel bzw. andererseits die Umschrift
mit dem Sterbevermerk noch in Gotischer Majuskel, der Geschlechtsname
des Verstorbenen auf dem Spruchband über dem Kopf der Figur als
unepigraphischem und genuin buchschriftlichem Schriftträger jedoch schon
in Gotischer Minuskel ausgeführt sind.
In einzelnen Anwendungsbereichen lebt die Gotische Majuskel jedoch
auch noch in der Frühen Neuzeit weiter. Der Kreuzestitulus einer ansonsten
in Gotischer Minuskel beschrifteten Glocke von 1504 (Kat.-Nr. 132) ist in
dieser Schriftart gestaltet, eine große Glocke von 1515 (Kat.-Nr. 153) gibt
zwei längere Texte in Gotischer Majuskel wieder. Noch eine Tischglocke
von 1544 (Kat.-Nr. 220†) kombinierte Frühhumanistische Kapitalis und
eine allerdings durch sehr lineare Ausführung trotz Perlsporen als Zierelemente
leblos und starr wirkende Gotische Majuskel für zwei unabhängige
Texte.
5.2. Gotische Minuskel (vgl. die abgebildeten Nachzeichnungen)
Von den Erstbelegen in sehr spezifischen Anwendungszusammenhängen von
1363 und 1370 (Kat.-Nr. 27 und 28, s. auch oben) bzw. dem ersten Einsatz
für einen längeren Text, die Grabinschrift des Peter Echinger von 1381
(Kat.-Nr. 30), an stellt die Gotische Minuskel für etwa eineinhalb Jahrhunderte
die einzige quantitativ relevante epigraphische Schriftart des bearbeiteten
Bestands dar.
Eine konsequente Entwicklung innerhalb dieses Zeitraums nachzuzeichnen
fällt schwer. Die jeweilige Ausformung des Grundkanons scheint weniger
von wechselnden Moden der Schriftgestaltung abhängig als vielmehr
dem Vermögen der Ausführenden geschuldet, die im Grunde feststehenden
Stilisierungsprinzipien der vorbildhaften buchschriftlichen Textura höchsten
Anspruchs konsequent und mit entsprechendem epigraphisch-kalligraphischem
Niveau umzusetzen. Immerhin lassen sich gewisse grobe Tendenzen, die an der Mehrzahl des
Materials abzulesen sind, wie folgt zusammenfassen.
Vom letzten Viertel des 14. bis etwa ins erste Viertel des 15. Jahrhunderts
sind Inschriften in Gotischer Minuskel überwiegend relativ breit proportioniert
und eher locker gesetzt. Der Abstand zwischen zwei nebeneinanderstehenden
Schäften ist in der Regel deutlich größer als die Schaftstärke
bemessen. Die Höhenausdehnung der Gemeinen ist tendenziell oder vollständig
auf das Mittelband beschränkt, wodurch bei jenen Buchstaben, die
Unterlängen besitzen, die eigentlich im Mittelband des Vierlinienschemas
stehenden Bestandteile auf die oberen zwei Drittel desselben reduziert werden
müssen (vgl. besonders g und p in Kat.-Nr. 30), auch der Balken von f
und t kann aus diesem Grund gegen die Mittellinie zu nach unten rutschen.
Die Hervorhebung des Mittelbands wird auch durch eine meist sehr geringe
Zahl an Versalien – mitunter nur das der Gotischen Majuskel entnommene
A eines einleitenden Anno domini – gefördert. Über das breite Formenrepertoire
bei der Gestaltung der Versalien zu Inschriften in Gotischer
Minuskel geben die Nachzeichnungen besseren Aufschluß als eine verbale
Beschreibung.
Vereinzelt bevorzugen Inschriften dieses Zeitabschnitts und bis etwa zur
Mitte des 15. Jahrhunderts v gegenüber u auch im Wortinneren und für den
vokalischen Lautwert. Haarzierstriche etwa am oberen Bogen des a, an e,
am Balken von t und dem Bogen des r sind mit Ausnahme gemalter Inschriften
eher selten, i wird kaum mit Punkt oder Quadrangel über dem
Schaft markiert. Bogenverbindungen (etwa bei p͜p, d͜e u. a.) sind häufiger als
in späteren Inschriften zu beobachten.
Zu Beobachtungen über mutmaßliche Werkstattzusammenhänge
einzelner Grabdenkmäler und anderer Inschriftenträger dieses Zeitraums vgl.
anhand inschriftenpaläographischer und stilistischer Detailmerkmale ausführlich
Kat.-Nr. 40, 41, 43, 44, 46, 49, 55 und 59, wonach offenbar zwei verschiedene
Werkstätten – eine davon vielleicht mit Sitz in Göttweig – im Bearbeitungsgebiet
besonders produktiv waren.
Ab dem zweiten Drittel und besonders der Mitte des 15. Jahrhunderts lassen sich häufiger
Tendenzen erkennen, Schaftstärken und Schaftabstände einander anzunähern, wodurch ein vergleichsweise
dichteres, einförmigeres, gitterartiges Schriftbild mit überwiegend schlankeren,
schmäleren Proportionen entsteht. Gleichzeitig nützen nun fast immer die Gemeinen Ober- und
Unterlängenbereich mehr aus, wodurch etwa der Bogen des g nicht nur das Mittelband durchbricht,
sondern im Unterlängenbereich auch nicht selten nach rechts ausholt, die Zahl der zunehmend
komplizierter aufgebauten und zierlicheren Versalien wird größer und tritt ebenso wie
die reichere Verwendung von oft tropfenförmig auslaufenden Haarzierstrichen einem monotoner
werdenden Schriftcharakter entgegen.
Zu den Arbeiten einer um die Mitte des 15. Jahrhunderts vor allem in Oberösterreich außerordentlich
produktiven Werkstatt gehören im Bearbeitungsgebiet die Grabplatte des Hans Sulzperger
(Kat.-Nr. 63) und die Wappengrabplatte des Hans (VI.) und der Anna von Neidegg (Kat.-Nr. 80).
Die dort angedeuteten gestalterischen Charakteristika der Wappendarstellungen (wobei
die Konturen des vertieften Wappenfelds oft in unregelmäßigem Verlauf dem Umriß des Vollwappens
folgen) bzw. weit überwiegend übereinstimmende Schriftformen einschließlich der charakteristischen
Versalien (A, E, G, H, O, S u. a.) zeigen neben zahlreichen anderen u. a. die
Wappengrabplatte des Wolfgang und der Elisabeth von Ahaim (1450) in der Pfk. Alkoven150, die
beschädigte Wappengrabplatte eines Angehörigen der Jörger (um 1450) an der Pfk. St. Georgen
bei Grieskirchen, die Wappengrabplatten der Marichstain in der Pfk. Lorch und des Hans Hohenfelder
von Aistersheim in der Pfk. Aistersheim (beide um 1450), die Wappengrabplatte des Jörg
Perkheimer (um 1450) in der Fk. Schöndorf, zwei Fragmente der Priestergrabplatten des Lambert
Werktag (gest. 1456) und des NN . (gest. 1454) bzw. das Fragment der Wappengrabplatte des
Stephan Hutstock, seiner Frauen Elisabeth und Katharina und eines Sohnes Andreas in der Pfk.
Lorch, die Wappengrabplatten des Kaspar Albrechtsheimer (gest. 1457) in Waldkirchen am Wesen
und des Valentin Perkhaimer (gest. 1457) in der Heiligkreuzkirche in Burghausen151, die Wappengrabplatten
des Ennser Stadtrichters Matthäus Seidenschwanz (gest. 1458) im Museum Lauriacum
Enns152 und des Kaspar und des Balthasar Schallenberger (1457) in der Pfk. Niederwaldkirchen153.
Alle Charakteristika der genannten Arbeiten dieser Werkstatt zeigen die Wappengrabplatten des
Friedrich Egker (gest. 1388) an der Eferdinger Stadtpfarrkirche und der Elisabeth von Starhemberg
(gest. 1418) in der Pfk. Hellmonsödt, die demnach erst in den 1440er oder 1450er Jahren
entstanden sein dürften154. Auch die jüngeren Wappengrabplatten des Pankraz Cziner (gest. 1460)
in der Klosterkirche Engelszell, des Ulrich Prandstetter (gest. 1461) in der Pfk. Pischelsdorf am
Engelbach und des Erasmus und des Ulrich U(e)tzinger (1464) in der Nord- bzw. Heiliggrab- oder
Grundemannkapelle in Wilhering weisen ebenso wie die undatierte Wappengrabplatte für die
Mühlwanger in der Pfk. Altmünster noch alle charakteristischen Merkmale der Werkstatt auf155.
Übereinstimmende Schriftformen zeigen die Grabplatte des Ulrich Seidenschwanz (gest. 1444)
und die fragmentierte Grabplatte der Elisabeth Choian (gest. 1449) in der Pfk. Lorch, die Priestergrabplatte
des Hermann Poll (um 1450) in der Klosterkirche Pulgarn156, die Wappengrabplatte
der Tattenbacher (um 1450) im Kreuzgang von Raitenhaslach157, die Wappengrabplatte der
Elisabeth Stetheimer (gest. 1453) in der Pfk. Arbing, die Priestergrabplatte des Pfarrers Markward
(gest. 1454) in der ehem. Pfarr-, jetzt Friedhofskirche Puchenau, die Wappengrabplatte des Simon
Rieder von Scharfenfeld (gest. 1454) in Baumgartenberg158, die beschädigte Wappengrabplatte
des Martin Steinberger (um 1450) aus der Pfk. Pergkirchen, heute in der Schloßkapelle Auhof,
und die stark abgetretene Grabplatte des Thomas Leroch in der Klosterkirche Lambach159. Ebenfalls
zu dieser Gruppe gehört angesichts der Charakteristika der Wappengestaltung die stark abgetretene
Grabplatte eines Angehörigen der Stetheimer an der Eferdinger Stadtpfk. Eine teilweise
unter einem Altarsockel verborgene Wappengrabplatte in Baumgartenberg trägt die für einen
späteren Nachtrag vorgesehene unvollständige Jahresangabe 1430, muß jedoch nach dem zeitlichen
Ansatz der oben genannten Denkmäler später entstanden sein.
Eine Gruppe von drei weitgehend einheitlich gestalteten Priestergrabplatten aus der Mitte des
15. Jahrhunderts in Stift Ardagger, die Denkmäler des Kanonikers Peter von Steinakirchen
(M. 15. Jh.), des Pfarrers von Behamberg, Paul Weiß (gest. 1452), und des Dekans von Ardagger
und Pfarrers von Wartberg, Thomas Strabhofer (gest. 1453), weist auch in der Schriftgestaltung
ebenso wie die am selben Standort befindliche Wappengrabplatte des Thomas und der Martha
Erhart (1457) verbindende Merkmale auf, die denen der genannten Arbeiten entsprechen160. Die
Grabplatte des Eferdinger Priesters Stephan Kropf (gest. 1450)161 zeigt in der Inschrift zwar lediglich
den einleitenden Versal R mit Zackenleiste, das auf dem Wappenschild unterhalb des Kelchs
dargestellte S in Gotischer Majuskel entspricht aber in der stark linksschräg geneigten Längsachse
des Buchstabens eindeutig der signifikanten Usance der Werkstatt.
Die Priestergrabplatte des Eferdinger Pfarrers Ulrich Deinsdorfer (gest. 1465)162 benützt unverkennbar
die gewohnten Grundformen der Versalien A, G und H, an deren spezifischer Ausprägung
aber bereits kleine Veränderungen abzulesen sind. Konservativer sind dagegen die Inschriften
der Wappengrabplatten des Raitenhaslacher Klosterrichters Erasmus Wiels von Rainding
(gest. 1466) im Kreuzgang von Raitenhaslach163 und des Kirchberger Vikars Stephan Loser (um
1460) in Mining. Einzelne deutlich spätere Denkmäler wie die Wappengrabplatten des Jörg (d.
Ä.) von Seisenegg (1470?) in Baumgartenberg164, des Stephan Handschuster (gest. 1471) in der
Pfk. Stein165 und des Wolfgang Chlötzl (gest. 1478) in der Stadtpfk. Braunau a. I. zeigen in der
Gestaltung des Wappenfelds noch spürbare Anklänge an die Usancen der älteren Werkstatt.
Die bislang einzigen dem Verfasser bekannten figürlichen Grabplatten aus dieser Werkstatt
sind das Denkmal der Zaunrüd im Raitenhaslacher Kreuzgang (um 1450)166 und die stark abgetretene
Grabplatte des Abtes Stephan von Dornach (gest. 1454) in Baumgartenberg mit der graphisch-
linear eingehauenen Figur des Verstorbenen in Pontifikalgewändern167. Die jeweiligen
Umschriften weisen in ihren Schriftformen sämtliche Merkmale der vorgenannten Steine auf. Ob
die figürliche Tumbendeckplatte vom Memoriengrab des Otto von Machland in Baumgartenberg168
angesichts mehrerer Parallelen in der Schriftgestaltung möglicherweise ebenfalls aus demselben
Werkstattverband stammt, ist noch zu klären.
Auffällig ist der etwa die Hälfte ausmachende Anteil an Denkmälern dieser Werkstatt, die
entgegen dem ansonsten noch überwiegenden Usus der Jahrhundertmitte eine zeilenweise Beschriftung
aufweisen. Nicht selten finden sich unterhalb eines größeren Vollwappens zwei oder mehr kleinere,
oft aneinandergelehnte Beiwappen. Beiwappen, Bilddevisen von Ritterorden und Spruchbänder füllen
mitunter auch die Zwickel am Oberrand eines Wappenfelds aus. Eine Gruppe von vier fragmentierten
Grabplatten und einer Wappengrabplatte aus Eferding (Stephan Schuthauptl und Ehefrauen, 1460,
Erhard Schneider, 1460, Hans Prantner und Ursula Paidler)169 zeigt nicht nur untereinander
klare Übereinstimmungen im inschriftlichen Formenbestand, sondern auch deutliche Nähe zu den
Schriftformen der beschriebenen Werkstätte. Auffällig ist jedoch das von allen vorgenannten Steinen
(Rotmarmor) abweichende Material, hier ein offenbar lokal gewonnenes grobkörniges und relativ stark
sandendes Gestein.
Auch die Gruftplatte (?) des Albrecht Puschinger (Kat.-Nr. 67) und die Wappengrabplatten
Christophs (d. J.) von Hohenfeld (Kat.-Nr. 97) und des Achaz Vindinger (Kat.-Nr. 145) konnten
jeweils aufgrund ihrer Schrift- und Wappenformen in einen größeren Werkstattzusammenhang
gestellt werden.
Eine bescheiden stilisierte Gotische Minuskel von 1489 (Kat.-Nr. 94) ahmt offenbar eine
Bandminuskel nach, die früheste erhaben gearbeitete Inschrift stammt von 1495 und trägt einigen
schriftgestalterischen Anspruch vor (Kat.-Nr. 99). Da aus technischen Gründen bei erhaben ausgeführten
Inschriften die Schaftstärken üblicherweise größer bemessen sind als bei eingehauenen,
rücken die Quadrangeln benachbarter Schaftenden so eng zusammen, daß sie eine besonders an
der Basislinie auffallende, durchlaufende sägezahnartige Linie ausbilden (vgl. auch Kat.-Nr. 181).
Um bzw. nach 1500 werden die zuletzt referierten grundlegenden Gestaltungsprinzipien bei
allerdings wieder etwas breiteren Buchstabenproportionen und weniger gedrängter Spationierung
meist weitergeführt, als zusätzliche Ziermöglichkeiten wird die Einkerbung und Gabelung freier
Schaftenden und das Einrollen von Haarzierstrichen öfter angewendet (vgl. etwa Kat.-Nr. 105).
Noch deutlicher als früher überwiegt bei Betrachtung der Einzelformen nun ein a, bei dem der
obere gebrochene Bogen gegenüber dem unteren stark verkleinert ist, Kasten-a bleibt zwar selten,
der Anteil der Belege am Gesamtbestand nimmt jedoch zu. Bogenverbindungen sind mittlerweile
praktisch völlig verschwunden. Die große Mehrzahl der Versalien ist nun vorbildhaften Gestaltungen
buchschriftlicher Anwendungsgebiete (Cadellen) entlehnt, vergrößerte Minuskelformen
oder Buchstaben der Gotischen Majuskel treten nicht völlig, aber weitgehend in den Hintergrund,
soferne sie nicht mit Haarzierlinien entsprechend adaptiert werden. Neu treten jedoch Buchstaben
aus dem Kapitalis-Alphabet in geringer Zahl als Versalien hinzu.
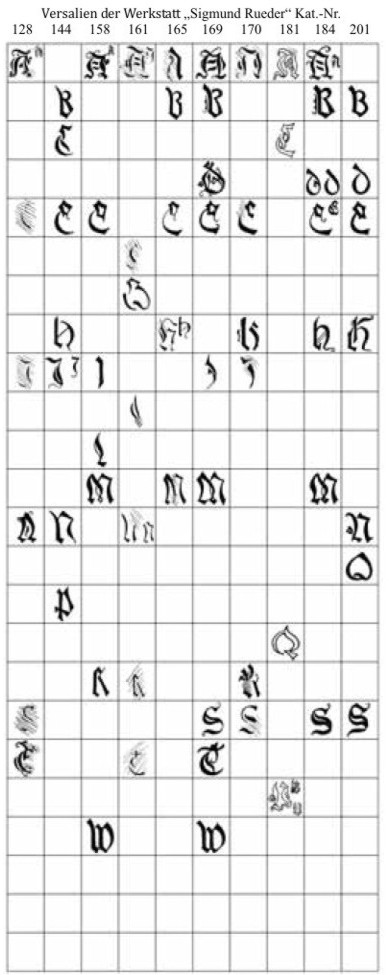
Die Tätigkeit spezialisierter und für den überregionalen Bedarf produzierender leistungsfähiger
Werkstätten läßt sich durch Kombination stilistischer und inschriftenpaläographischer
Merkmale besonders für die rotmarmornen Grabplatten des späten 15. und frühen 16. Jahrhunderts
mehrfach nachweisen (vgl. etwa Kat.-Nr. 128 und 145). Unter den spätgotischen Grabdenkmälern
des Bearbeitungsgebiets ragt im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts eine Gruppe von mehreren
Objekten (Kat.-Nr. 128, 144, 158, 161, 165, 169, 170, 181, 184, 201) heraus, die durch die meist
sehr offensichtlichen Parallelen im inschriftlichen Formenbestand, für den u. a. eine Reihe von
„kanonisierten“ Versalien (s. die umseitigen Nachzeichnungen) kennzeichnend ist, und analoge
Gestaltungsmerkmale im Bereich der Vollwappen bzw. der Figurenzeichnung und ornamentaler
Details als Arbeiten einer gemeinsamen, überaus produktiven Werkstatt erscheinen. Arbeiten
dieses Betriebs finden sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand in weiten Teilen Niederösterreichs,
vor allem aber in Oberösterreich. Karl Friedrich Leonhardt, der den Leiter der Werkstatt mit dem
angeblichen Burghausener Steinmetzen bzw. Bildhauer Sigmund Rueder identifizierte, erschloß
den Namen des Künstlers jedoch anhand eines Grabdenkmals im Bearbeitungsgebiet, nämlich der
figürlichen Grabplatte des Fr. Viktor Lauser in Spitz (Kat.-Nr. 181), bei der Leonhardt das unmittelbar
neben die kleine Figur des Hundes zufüßen des dargestellten Geistlichen gesetzte fec(it)
als „chiffrierte“ Künstlersignatur Rueders (Rüde!) deutete. Aus stilistischen Analogien zu diesem
niederösterreichischen Denkmal entwickelte Leonhardt dann eine Reihe von Denkmälern170, die
er Rueder zuzuschreiben können glaubte und schlug vor, in Rueder einen ehemaligen Gesellen
der Burghausener Werkstatt Franz Sickingers zu sehen171, was Ähnlichkeiten in der Wappengestaltung
der älteren Sickinger- und der jüngeren Rueder-Steine durchaus auch stilistisch nahelegen.
Ob der Leiter dieser extrem produktiven Werkstatt tatsächlich Sigmund Rueder hieß,
woran sich berechtigte Zweifel knüpfen, ist unerheblich. Seine Name wird hier in der Folge, da in der
Literatur eingeführt, vorerst benützt, jedoch lediglich unter Anführungszeichen und im Bewußtsein,
daß es sich um nicht wesentlich mehr als einen (durchaus willkürlichen) Notnamen handelt172.
Signifikant für die Kontinuität in der angesprochenen feststehenden Versalienverwendung
der „Rueder“-Werkstatt ist die Überlieferung von Zweitformen neben den ganz klar zahlenmäßig überwiegenden
„Leitformen“. Neben dem „genuinen“ Versal A mit zwei Schrägbalken findet sich etwa ebenso nur wenig
variiert ein aus der Verfremdung des Gotischen Minuskel-a geschaffener Versal. In Österreich lassen sich außerhalb
des Bearbeitungsgebiets jeweils anhand der Schriftformen (v. a. der charakteristischen Versalien), signifikanter ornamentaler
Details (etwa das Traubenornament und der Astwerkbogen), der Wappengestaltung und der Figurenzeichnung – ohne Anspruch
auf Vollständigkeit – folgende Denkmäler mit mehr oder weniger großer Wahrscheinlichkeit der „Rueder“-Werkstatt zuweisen:
die undatierte Wappengrabplatte des Braunauer Zöllners Ruprecht Tenngkh und seiner Frau Elisabeth an der Stadtpfk.
Braunau a. Inn, die Wappengrabplatte des Wolfgang Winter (gest. 1479) in der Pfk. Gmunden, die Priestergrabplatte des Erhard
Stettner (gest. 1503) in der Stadtpfk. Braunau a. Inn, die figürliche Grab- (oder Tumbendeck-)Platte des Hans und der
Elisabeth von Starhemberg (nach 1494), das Epitaph der Hedwig von Starhemberg (geb. von Rosenberg, gest. 1520)
und die figürliche Grabplatte des Bartholomäus
und der Magdalena von Starhemberg (vor 1531) an bzw. in der Pfk. Hellmonsödt173, das Epitaph
des Blasius Rosenstingl (gest. 1504?) in der ehem. Kloster-, jetzt Pfk. Ranshofen, das Epitaph des
Vikars Gregor Reiter (gest. 1519) in der Pfk. Ried i. Innkreis, die mit dem Relief eines Transi
gestalteten Tumbendeckplatten des Bernhard von Polheim (gest. 1504) in der Welser Stadtpfk.174
bzw. des Bernhard von Scherffenberg (gest. 1513) in der Pfk. Lorch175, das ebenfalls mit Relief
eines Transi (und einer Kreuzigungsgruppe) gestaltete epitaphartige Denkmal des Benefiziaten
Johannes Gletvischer in der Pfk. Lorch (um 1521?) und die fragmentierte Wappengrabplatte der
Barbara Reitwalder (gest. 1526) im Museum Lauriacum Enns176, die Wappengrabplatte des Kanonikers
Johannes Vreisenschnech (Vreisenschuech?, gest. 1508) an bzw. in der ehem. Kollegiatstifts-,
jetzt Pfk. Mattighofen177, die zentrale Relieftafel eines wohl ursprünglich gerahmten und
mit Sterbeinschriften des unterhalb einer Dornenkrönung dargestellten anonymen Stifterehepaars
versehenen Epitaphs aus Braunau (?) im Hof des Linzer Schloßmuseums (1510)178, das undatierte
Epitaph des Schneiders Jörg Pärt (?) in der Pfk. Uttendorf, das Epitaph des Ulrich Kainacher und
seiner beiden Frauen Barbara und Walpurga (1518) in der Liebfrauenkirche in Freistadt179 und die
unter Verwendung des oben genannten Bildvorwurfs (Kreuzigungsgruppe und liegender Transi)
gestalteten Epitaphien des Abtes Heinrich (II.) Kern in Baumgartenberg (1528) und des Benefiziaten
Wolfgang Kreuzer in der Pfk. Münzbach180, die Wappengrabplatte des Christoph und der
Magdalena Greisenecker (nach 1519) in der Nord- bzw. Heiliggrab- oder Grundemannkapelle in
Wilhering und die Wappengrabplatten des Christoph und der Apollonia Steinpeck (1505) bzw.
der Margarete Kirchberger (gest. 1509) sowie die figürliche Grabplatte des Sebastian Kirchberger
(gest. 1511) im Kreuzgang von Wilhering181, die Wappengrabplatte des Ulrich und der Barbara
von Pessnitz (1521) in der Pfk. Aspach und die Wappengrabplatte des Hans und der Amalia Eggenfelder
(vor 1532) in der Pfk. Mauthausen, die figürliche Grabplatte des Gregor von Starhemberg
(gest. 1522) und eine wohl etwa gleichzeitige Gruftplatte mit Relief eines Transi sowie die ursprünglich
in der unmittelbaren Umgebung aufgestellten gleichzeitigen Kreuzwegtafeln in der
Fk. Steinbruch182, die Wappengrabplatte des Wolfgang und der Apollonia Spiegel (gest. 1512) in
der Pfk. Traismauer, der epitaphartige „Pestgedenkstein“ des Pfarrers Johannes Hertting am Pfarrhof
Hartkirchen (zwischen 1522 und 1527)183, die Wappengrabplatte der Margarete Aspan zu
Lichtenhag (vor 1519), die Priestergrabplatte des Gregor Zändl (gest. 1519), die Wappengrabplatte
der Ehrentraud Tegernseer, geb. Dörfl (gest. 1521) und ein Relief Anna Selbdritt des Sebastian
Reintaler (undat.) an bzw. in der Stadtpfk. Eferding184, die Wappengrabplatte des Stephan
und der Magdalena Peck (gest. 1521) in der Pfk. Grieskirchen, die Priestergrabplatte des Kooperators
Martin Veldpacher in Pischelsdorf a. Engelbach (gest. 1521), die Teile von der Tumba des
Wolfgang und der Johanna von Polheim (gest. 1509 bzw. 1512) in der Pfk. Oberthalheim, die
figürliche Grabplatte der Vorster zu Hehenberg von 1519 in der Pfk. Vöcklamarkt, die figürlichen
Grabplatten des Andreas (Krabat) von Lappitz (vor 1506) an der Stadtpfarrkirche Amstetten, des
Wolfgang Meilersdorfer (um 1500?) in der Pfk. Wolfsbach und des Dekans Anton Engeygl (vor
1511) in der ehem. Kollegiatstifts-, jetzt Pfarrkirche Ardagger, die Wappengrabplatte des Chorherren
Hans Rambperger (vor 1534) am selben Standort, das Epitaph der Schrott von Streitwiesen
(1523) in der Pfk. Wieselburg185, die figürlichen Grabplatten des Pfarrers Paul Hackl (vor
1519) in der Pfk. Gottsdorf186, des Schönauer Pfarrers Johannes Lichtenberger (1528?) in der Pfk.
Münzbach und des Vikars Hans Grünwald (gest. 1510) in St. Laurenz bei Altheim, das Epitaph
des Benefiziaten Peter Engelberger (vor 1532) in der Pfk. Aspach und die Priestergrabplatte des
Benefiziaten Wolfgang Fabri in der Pfk. Ried i. Innkreis (vor 1536). In der Klosterkirche Frauenchiemsee
befindet sich mit der Wappengrabplatte der Dechantin Ursula Hintzenhauser (nach
1500) ein Stein mit den charakteristischen Schriftformen der Werkstatt, dem die Wappengrabplatte
der Konventualin Katharina Trauner (gest. 1521) im Klosterkreuzgang verwandt ist187. Das
Epitaph des Hans Herzheimer (gest. 1532) in der Klosterkirche188 bietet in den knappen Wappenbeischriften
wenig signifikante Vergleichsmöglichkeiten, ähnelt aber in der Gestaltung einer
halbfigurigen Maria mit Kind bzw. der des im Gebet knienden gerüsteten Verstorbenen und den
Details der Helmdecken dem überwiegenden Teil der Ruederschen Produktion. Den charakteristischen
Schnitt der Helmdecken und einzelne der gewohnten Versalien (etwa M) zeigt noch
die Wappengrabplatte des Heinrich Wydmann (gest. 1531) auf dem Salzburger St. Petersfriedhof189,
einzelne signifikante Versalien und der ältere Figurenstil begegnen auch noch auf den
figürlichen Grabplatten des Alexander Schifer von Freiling (gest. 1530) in der Eferdinger Spitalskirche
und des Wilboldt (Willibald) von Pirching (gest. 1536) an der Stadtpfk. Eferding190 sowie
des Vikars Wolfgang Hochh(...) (gest. 1503) in Pischelsdorf a. Engelbach. Die charakteristischen
Versalien der „Rueder“-Werkstatt zeigen die Priestergrabplatte des Stephan Aunpacher (gest.
1521), das Fragment der Grabplatte des Balthasar Winzerer (gest. 1521) und die Grabplatte der
Margarete Hertting (gest. 1499) in der Stadtpfk. Eferding191. Die Inschrift des Grabplattenfragments
der Kunigunde Moshamer und der Margarete Span in der Fk. Altenburg ist aus dem typischen
Formenkanon der Werkstatt zusammengesetzt192.
Die figürliche Grabplatte (vor 1522) des Priesters Ambros Mittermayr in Annaberg193 trägt in
der Gestaltung der Figur die typischen Züge eines Teils der Grabdenkmäler der „Rueder“-Werkstatt,
die Schriftformen zeigen jedoch fast keine Berührungspunkte. Starke Anklänge an die
Mehrzahl der Wappengrabplatten der „Rueder“-Werkstatt zeigt die Wappengrabplatte des Georg
Aspan zu Haag (vor 1515) in Annaberg194 in der Gestaltung des Wappenfelds, die Schriftformen
weisen jedoch eine größere Distanz auf. Dagegen erinnern die Schriftformen der Wappengrabplatte
des Wolfgang Mauerkircher (gest. 1511) in der Stadtpfk. Braunau a. I. und die der Wappengrabplatte
des Wolfgang von Elriching (gest. 1521) in Mining stark an die der „Rueder“-Werkstatt,
während die Gestaltung des Wappenfelds keine engeren Parallelen zeigt. Die in derselben Kirche
angebrachte figürliche Grabplatte des Wolfgang von Elriching entspricht dagegen auch in der
Figurenzeichnung dem gewohnten Kanon. Die Schriftformen, besonders mehrere Versalienformen,
aber auch Merkmale der Helmdecke der Vollwappen bzw. der Figurenzeichnung der qualitätvollen
Epitaphien des Wolfgang Pischelsdorfer (gest. 1520) in Braunau, des Kanonikers Thomas
Obeneiner (vor 1512) in der ehem. Kollegiatkirche Mattighofen bzw. des Wolfgang Tenk
(gest. 1507) an der Stadtpfk. Braunau a. Inn, des epitaphartigen Denkmals des Höglwörther Propstes
Christoph von Trenbach (vor 1522), der Wappengrabplatten des Tittmoninger Pfarrers
Wiguleius Fürst (nach 1520), des Nonnberger Kaplans Leonhard Nagwein (gest. 1526) und der
Äbtissin Ursula Trauner (gest. 1539) sowie der figürlichen Grabplatte der Äbtissin N. Pfeffinger
(gest. 1517) am Salzburger Nonnberg verweisen auf die „Rueder“-Werkstatt, ohne jedoch alle
gestalterischen Merkmale des weit überwiegenden Teils der Denkmäler aufzuweisen.
In den Schriftformen der Grabbezeugung, einer Gotischen Minuskel samt charakteristischer
Gestaltung der „kanonisierten“ Versalien, verweist das qualitätvolle, ungewöhnlich viele Versatzstücke
von Renaissance-Ornamentik aufnehmende, sekundär (?) polychromierte Rotmarmor-Epitaph des
Pfarrvikars Wolfgang Mairhofer in der Pfk. Hohenzell (vor 1533?) ebenfalls eindeutig
auf die „Rueder“-Werkstatt. Die oberen zwei Drittel der Platte nimmt jedoch eine in den
vorgenannten „Rueder“-Arbeiten beispiellose, sehr plastisch ausgeführte Darstellung des vor einer
thronenden Madonna mit Kind knienden Verstorbenen ein, die in eine von Pilastern mit Akanthusdekor
an den Kapitellen aufgespannte Rundbogennische mit Muschelsegmentbogen eingestellt
ist. Die mit vegetabilem Ornament gefüllten Zwickel zeigen links einen Wappenschild mit
dem verschränkten Monogramm des Verstorbenen, rechts ein Buch. Der Rundbogen über der
Madonna weist die Fürbittheische MARIA VIRGO VIRGINVM ORA PRO NOBIS in einer bis
auf einzelne verfremdete Formen, die der Frühhumanistischen Kapitalis entlehnt sind (A mit
senkrecht gestelltem rechten Schägschaft und links überstehendem Deckbalken und N mit Siculus
am Schrägschaft), als erhaben gearbeitete Renaissance-Kapitalis, wenn auch mit schmalen
Proportionen, anzusprechende Schriftart auf, die ebenfalls ohne Parallele in den sonstigen Arbeiten
der Werkstätte bleibt. Die Kapitalis der Wappenbeischriften auf dem Denkmal für Wilbolt
(Willibald) von Pirching zeigt dagegen breitere Proportionen und abweichende Einzelformen
(etwa R). Ebenfalls aus der „Rueder“-Werkstatt stammt zweifellos das Tympanon der ehem.
Klosterkirche Baumgartenberg mit Gedenkinschrift auf Otto von Machland, heute im OÖ
Landesmuseum195.
Deutlich seltener finden sich Arbeiten der Werkstatt außerhalb der donauösterreichischen
Länder. Immerhin sind in der Steiermark die Wappengrabplatte (bzw. das Epitaph) des Ernst von
Trauttmansdorff (gest. 1517) in Trautmannsdorf und ein Kreuzigungsrelief (um 1510) in Gnas
sowie das äußerst qualitätvolle figürliche Grabdenkmal des Achaz von Magknitz (gest. 1526) in
Metnitz zu nennen. Vereinzelt lassen sich entsprechende Arbeiten auch in Südböhmen nachweisen,
wie etwa die vor 1520 entstandene Wappengrabplatte des Kaspar Gobmhapp von Suche (?) im
ehem. Dominikanerkloster Budweis.
Gegen Ende des ersten Viertels des 16. Jahrhunderts lassen sich in den Inschriften des Bearbeitungsgebiets
vereinzelt Auflösungserscheinungen in Bezug auf die strengen Stilisierungsmerkmale
der Gotischen Minuskel feststellen, wie ein Zug zur Durchbiegung von Schäften, zur Umsetzung
von Bögen als Schwellzüge und zu einer runderen Auflösung gebrochener Bögen (vgl.
Kat.-Nr. 171, 177 und 204). Der Schaft des t ragt nun mitunter deutlich in den Oberlängenbereich,
das Setzen von i-Punkten stellt den Normalfall, das von Häkchen über u keine Seltenheit dar.
Den Zeitpunkt, an dem die Gotische Minuskel wenigstens von anspruchsvollen Auftraggebern
für konservativ bis veraltet und als jedenfalls einer lateinischen Bildungssprache (pseudo-)humanistischen
Zuschnitts nicht mehr adäquat erachtet wurde, markiert das 1532 entstandene Epitaph
des Göttweiger Abtes Matthias von Znaim (Kat.-Nr. 204). Der deutschsprachige Sterbevermerk
wurde zwar noch in Gotischer Minuskel eingehauen, der versifizierte lateinische Text steht jedoch
bereits in Renaissance-Kapitalis. Mit Ausnahme zweier Nachzügler von 1553 und 1559 – vielleicht
nicht nur zufällig, sondern in bewußtem schriftgestalterischen Konservativismus die Grabinschriften
auf die letzten Angehörigen ihrer adeligen Geschlechter bzw. Familienzweige (Kat.-Nr. 247
und 256) – stellt dieses Denkmal den letzten Beleg der langlebigsten epigraphischen Schriftart des
Bestands dar, die ebenso unvermittelt von der inschriftenpaläographischen Bildfläche verschwand,
wie sie auf ihr erschienen war.
5.3. Frühhumanistische Kapitalis und von ihr abgeleitete Majuskelmischschriften
(vgl. die abgebildeten Nachzeichnungen)
Neben einer schlecht datierbaren Verwendung für das Jesugramm auf einer museal aufbewahrten
Altarpredella (Kat.-Nr. 109) bietet der Flügelaltar von Maria Laach a. Jauerling aus dem letzten
Viertel des 15. Jahrhunderts (Kat.-Nr. 110) den ersten leidlich gut zeitlich einzuordnenden Beleg
für die Frühhumanistische Kapitalis im vorliegenden Bestand. Schon dieses erste Auftauchen weist
auf jene „Sonder“-Anwendungsbereiche hin, in denen der offensichtlich als dekorativ, vielleicht
aber auch als letztlich artifiziell und unorganisch empfundene Schrifttyp gegen Ende des 15. und
im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts als Modeschrift überwiegend zum Einsatz kam: kurze
Inschriften auf gewissermaßen peripheren zu beschriftenden Objekten bzw. Schriftfeldern, oft in
einem in weiterem Sinn kunsthandwerklichen Kontext und aufgemalt, kaum aber für längere
Texte herangezogen und in Stein gehauen.
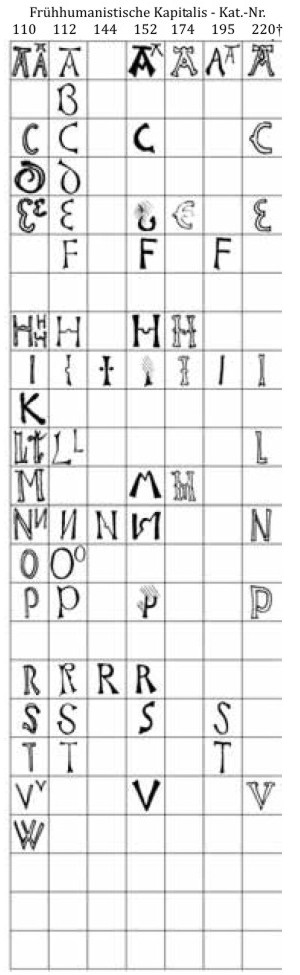
Auf dem Maria Laacher Altar tritt sie, vielleicht als Produkt einer Passauer Werkstatt, einerseits
auf dem Gewandsaum Christi mit einen stärker linearen Eindruck auf: Haar- und Schattenlinien
sind kaum differenziert, freie Schaft-, Balken- und Bogenenden stumpf abgeschnitten. Das verwendete
Alphabet ist mit Ausnahme einiger weniger Buchstaben (A mit beidseitig überstehendem
Deckbalken, epsilonförmiges E, retrogrades N) und abgesehen von den spärlichen für den Schrifttyp
charakteristischen Zierlelementen (etwa der Siculus am Balken von H) jenes der Kapitalis.
Deutlicher gehören die schmalen Proportionen und die fast gelängt wirkenden Buchstaben zum
Schriftbild der Frühhumanistischen Kapitalis. Andererseits begegnet eine deutlich abweichende
Ausprägung auf dem Armausschnitt im Gewand eines Schergen und in den Namensbeischriften
der weiblichen Heiligen auf der Predella. Deren Einzelformen sind weniger schmal und zeigen
Gestaltungsmerkmale, die den Rahmen reiner Kapitalis sprengen: trapezförmiges A mit beidseitig
überstehendem Deck- und teilweise gebrochenem Mittelbalken sowie unziales D. Freie Schaftund
Bogenenden sind hier nicht selten dreieckig gestaltet, mitunter eingekerbt, gegabelt oder
gespalten.
Die gedrängt angeordneten, sehr dünnstrichigen Buchstaben der Bauinschrift des steinernen
Kanzelkorbs vom Ende des 15. Jahrhunderts in Hofarnsdorf (Kat.-Nr. 112) sind fast durchwegs
schmal und schlank proportioniert. Freie Schaft-, Balken- und Bogenenden tragen kleine Dreiecke
oder erhalten Einkerbungen. A zeigt beiderseits überstehenden Deckstrich und gebrochenen
Balken, das unziale D hat ebenso wie O einen moderat spitzovalen Bogen, E ist epsilonförmig.
Am Balken von H sitzt ein nach unten geöffneter Siculus, ein nach rechts geöffneter befindet sich
in der Schaftmitte von I. Der sehr kleine Bogen des R ist am oberen Berührungspunkt mit dem
Schaft etwas eingedrückt, auf der geraden Cauda sitzt unterhalb der Mittellinie ein stachelartiger Sporn.
Gewisse charakteristische Formbildungen Frühhumanistischer Kapitalis, etwa die spitzovale
Form des O und der Nodus am Schaft des I waren um 1500 offenbar soweit epigraphisches
Gemeingut, daß sie auf die formal entsprechenden Ziffern übertragen werden konnten (Kat.-Nr. 126).
Auf dem Haitzendorfer Epitaph von 1511 steht der Kreuzestitulus in durchaus typischer
Frühhumanistischer Kapitalis (Kat.-Nr. 144). Eine Glocke von 1521 (Kat.-Nr. 174) weist die charakteristischen
Einzelformen von A mit kräftigem Deckstrich, aus Nodus am Berührungspunkt
der beiden Schrägschäfte und nach beiden Seiten ausgehenden kurzen dreieckigen Balken zusammengesetzt,
und „byzantinisches“ M auf, Nodi in den Schaftmitten und kräftige Perlsporen
an freien Schaftenden ergänzen das Bild. Retrogrades N und schmale, lineare Buchstaben zeigt
eine möglicherweise zu 1526 zu datierende kurze an die Wand gemalte Inschrift in Göttweig
(Kat.-Nr. 195). Die in Kombination mit Gotischer Majuskel für einen zweiten Text auf einer
Tischglocke von 1544 (Kat.-Nr. 220†) angebrachte Inschrift in Frühhumanistischer Kapitalis verwendet
A mit beidseitig überstehendem Deck- und gebrochenem Mittelbalken und epsilonförmiges E.

Elemente der Frühhumanistischen Kapitalis haben bedeutenden Anteil an der aus unterschiedlichen
Schrifttraditionen amalgamierten Majuskelmischschrift einer Beckenschlägerschüssel in
Göttweig, die wohl am Beginn des 16. Jahrhunderts in Nürnberg hergestellt wurde (Kat.-Nr.
121). Substrat der Frühhumanistischen Kapitalis bildet die wichtigste Zutat einer in zahlreichen
Varianten bis etwa in die späten 1540er Jahre und teilweise noch länger im Bearbeitungsgebiet
und darüber hinaus im niederösterreichischen Waldviertel in Verwendung stehenden Majuskelmischschrift
auf im wesentlichen kapitaler Grundlage mit einzelnen markanten und dekorativen oder zahlreicheren,
den Gesamteindruck bestimmenden Verfremdungen (vgl. Kat.-Nr. 152, 228 und 274).
Die schlanken Proportionen und einzelne Leitbuchstaben der Frühhumanistischen Kapitalis übernehmen
auch die Kapitalis-Inschriften der Kacheln eines aus der Mitte des 16. Jahrhunderts stammenden Objekts (Kat.-Nr. 240).
5.4. Gotico-Antiqua (vgl. die
abgebildeten Nachzeichnungen)
Dieser Schrifttyp ist im Bezirk Krems lediglich durch fünf Inschriftenträger vertreten, für die eine
Anfertigung durch auswärtige Kräfte angenommen oder wenigstens nicht ausgeschlossen werden kann.
Bezeichnenderweise scheint in vier Fällen mehr oder weniger direkt faßbarer Einfluß aus Passau,
offenbar dem eigentlichen Kerngebiet der inschriftlichen Gotico-Antiqua in Süddeutschland196,
vorzuliegen. Der wohl noch gegen Ende des 15. Jahrhunderts mit dem Namen des Bauherren bzw. Besitzers
Erhard Kobolt beschriftete Konsolstein vom Erker eines Hauses in der bischöflich-passauischen
Stadt Mautern (Kat.-Nr. 113) zeigt eine sehr dünnstrichig ausgeführte Gotico-Antiqua. Reminiszenen
an Gotische Minuskel sind vielleicht noch an der Einzelform eines t mit sehr kurzem Schaft feststellbar,
Brechungen sind nicht mehr vorhanden. An der Basislinie werden die freien Schaftenden nach rechts,
im Oberlängenbereich nach links umgebogen oder rechtsschräg abgeschnitten.
Die Wappengrabplatte des Jörg Heidelberger von Heinrichschlag von 1502 (Kat.-Nr. 127) und die
nach 1506 entstandene figürliche Grabplatte seines Brudes Wolfgang (Kat.-Nr. 137) wurden bereits
früher als Arbeiten aus der Passauer Werkstatt Jörg Gartners identifiziert. Zur ausführlichen Schriftbeschreibung
beider Steine vgl. den Katalog an der zuletzt genannten Stelle.
Die dem von Ramona Epp sogenannten „Derrertyp“197 einer Passauer Werkstatt entsprechende
Inschrift auf der Grabplatte des 1540 in Unterloiben verstorbenen und beigesetzten Passauer Bürgers
Wolfgang Rothofer (Kat.-Nr. 213) weist im Formenbestand und den Stilisierungsmerkmalen starke
Residuen der Gotischen Minuskel auf, die einzelnen für die Gotico-Antiqua charakteristischeren Buchstaben
und der allgemeinen Neigung zu spitzovalen Bögen gegenüberstehen. Freie Schaftenden mehrschaftiger
Buchstaben werden an der Basislinie stumpf abgeschnitten. Die Gestaltung eines P-Versals
verrät zudem Beeinflussung durch zeitgleiche Fraktur.
Die Gotico-Antiqua einer singulären gemalten Weiheinschrift (Kat.-Nr. 184a), wohl aus dem
ersten Viertel des 16. Jahrhunderts, erinnert in Duktus und bestimmten Einzelformen (etwa a)
an Traditionen der Gotico-Antiqua des Buchdrucks bzw. an deren mittelbares handschriftliches
Vorbild, die italienische Rotunda des mittleren 15. Jahrhunderts.
5.5. Kapitalis
Nach einem mutmaßlich 1511 mit dem Kreuzestitulus beschrifteten Schlußstein in der Pfarrkirche
Engabrunn (Kat.-Nr. 147), zu dem jedoch aufgrund von dessen Anbringungshöhe und wegen
einer sekundären Polychromierung keine inschriftenpaläographischen Angaben gemacht werden
können, überliefert erst das Epitaph des Göttweiger Abtes Matthias von Znaim von 1532
(Kat.-Nr. 204) den ersten sicheren Nachweis einer (Renaissance-)Kapitalis im Bestand. Die Schrift,
von einer Werkstatt ausgeführt, die auf demselben Stein auch eine Gotische Minuskel ansprechender,
aber nicht überdurchschnittlicher Qualität angebracht hat, ist bereits bei ihrem ersten Auftreten
voll entwickelt und wurde mit zwar gutem Niveau der Schriftgestaltung, aber mangelhaftem
Layout ausgeführt. Die Buchstaben sind überwiegend relativ schmal ausgefallen, der Wechsel
von Haar- und Schattenstrichen ist bei kräftigem Strich nur schwach ausgeprägt, an freien
Schaft-, Balken- und Bogenenden sitzen dreieckige Sporen. Das spitze Zusammentreffen zweier
Schrägschäfte bzw. von Schaft und Schrägschaft an Ober- und Basislinie bereitet Schwierigkeiten,
sodaß etwa A einen kräftigen dreieeckigen Sporn an der Oberlinie zeigt. B zeigt zwei gleich
große Bögen, das schmale C läuft am oberen Bogenende spitz aus, das untere Ende ist mit rechtsschräg
abgeschnittenem Sporn versehen, die drei Balken des E sind gleich lang, G hat eine kurze senkrechte Cauda,
I einen Dreispitz als i-Punkt. Der Mittelteil des konischen M reicht tendenziell bis zur Basislinie,
O hat schmale, teils beinahe spitzovale Form, R und Q haben stachelförmige Cauden,
V weist ein redundantes Häkchen als diakritisches Zeichen auf.
Die zeitlich nächste Kapitalis-Inschrift wurde von der Werkstatt des Wiener Bildhauers Konrad
Osterer auf dem figürlichen Grabdenkmal des Göttweiger Abtes Bartholomäus Schönleben
(Kat.-Nr. 208) 1537 mit hohem Anspruch eingehauen, doch sind Mängel der nicht immer ganz
geglückten Spationierung zu konstatieren. Die Einzelformen sind hier überwiegend relativ breit,
der Wechsel von Haar- und Schattenstrichen, fast durchwegs unter Betonung der Senkrechten
und der Linksschrägen, ist moderat ausgeprägt. Freie Schaft-, Balken- und Bogenenden sind mit
meist sorgfältig ausgeführten Serifen versehen. Am Berührungspunkt der beiden Schrägschäfte
des A entsteht wieder eine spornartige Abflachung, B zeigt dagegen nun einen erheblich größeren
unteren Bogen, oberes und unteres Bogenende von C enden meist auf gleicher Höhe. E besitzt
einen verkürzten mittleren Balken, G eine bis zur Mittellinie reichende senkrechte Cauda. Das
M folgt dem konischen Typ, wobei der Mittelteil nur etwa ein Drittel der Höhe des Schriftbands
ausmacht, die abwechselnd gerade bzw. stachelförmige R-Cauda verläuft steil und nahe am Schaft.
Die Kapitalis setzt sich sehr rasch für Inschriften aller Art sowohl in lateinischer wie in
deutscher Sprache ohne erkennbare Schrifthierarchie und ohne erkennbaren Einfluß sozialer
Differenzierungen der Auftraggeber (vgl. als erste deutschsprachige Grabinschrift in Kapitalis für
adelige Verstorbene Kat.-Nr. 210 von 1539) durch und verdrängt damit schneller als die Fraktur
die Gotische Minuskel. Eine kontinuierliche Schriftentwicklung innerhalb des Bestands vermochte
der Bearbeiter nicht zu beobachten. Kernpunkt der Bewertung ist die jeweilige Nähe
oder Distanz einzelner Inschriften zu den letztlich im Grunde vorbildhaften klassischen Schriftformen
und Gestaltungsprinzipien. Wohl läßt sich für die Mehrzahl der Kapitalis-Inschriften des
gesamten Katalogs ohne zeitliche Schwerpunkte eine mäßig breite Proportionierung, ein wenig
ausgeprägter Wechsel von Haar- und Schattenstrichen (die Schattenachse ungewöhnlicherweise
in den Rechtsschrägen bei Kat.-Nr. 352), eine Bevorzugung des B mit ungleich großen Bögen,
E mit kürzerem Mittelbalken (seltener auch mit verlängertem unteren Balken, s. etwa Kat.-Nr.
328), G mit senkrechter Cauda (rechtwinkelig geknickt noch häufiger im 16. Jahrhundert, vgl.
Kat.-Nr. 218 und 223, seltener im 17. Jahrhundert: Kat.-Nr. 395) und eher gerades als konisches
M mit meist nicht ganz bis zur Basislinie reichendem Mittelteil beobachten. Versuche, in Adaption
klassischer Vorbilder den Bogen von P (mitunter auch die von B und den von R) nicht ganz bis
zum Schaft zu schließen, sind selten (vgl. Kat.-Nr. 288, 299 und 323) und noch seltener geglückt.
Um die Mitte des 16. Jahrhunderts und noch geraume Zeit danach lassen sich noch A mit einoder
beidseitig überstehendem Deckstrich und gebrochenem Balken (vgl. etwa Kat.-Nr. 223, 224,
274, 377 und 386) und H mit Siculus oder Nodus am Balken (Kat.-Nr. 252 und 272) feststellen.
Bei C werden oberes und unteres Bogenende im 16. Jahrhundert noch häufig auf gleicher Höhe
abgeschnitten und mit Serifen oder kleinen Dreiecken versehen, später überwiegt C mit spitz
zulaufendem unteren Bogenende. Ein oben offenes D von 1574 bleibt singulär (Kat.-Nr. 283),
aus zwei aneinandergeschobenen VV gebildetes W taucht nur einmal auf (vgl. die allerdings in
lateinischer Sprache abgefaßte Inschrift in Kat.-Nr. 481), zweistöckiges Z fand in reinen Kapitalisinschriften
ebenso nur einmal Verwendung (Kat.-Nr. 289). Freie Schaft-, Balken- und Bogenenden
werden im 16. Jahrhundert noch mitunter dreieckig gestaltet, nach 1600 erscheinen fast
ausnahmslos Serifen bzw. rechtsschräge Balkensporen. Im 17. Jahrhundert überwiegt auch R mit
geschwungener Cauda die Gestaltung mit gerader Cauda noch deutlicher, als dies zuvor zu beobachten
war. Stachelförmige Cauden sind nur in überdurchschnittlich gelungenen Inschriften
zu finden (vgl. etwa die Glockeninschriften Kat.-Nr. 221 und 382). Das Graphem Y wird in einer
Inschrift von 1560 (Kat.-Nr. 257) noch von der Kombination IJ vertreten, über beiden Schäften
sitzt je ein Quadrangel als diakritisches Zeichen. Z trägt nach einem Erstbeleg von 1547 (Kat.-Nr.
223) erst nach der Jahrhundertwende häufiger einen meist geschwungenen Mittelbalken. U ist
– im Wort JESU – erstmals 1616 belegt (Kat.-Nr. 411), wobei die Verwendung für die Beschriftung
eines Buchdeckels in einem Porträt Zweifel am genuin epigraphischen Charakter des Belegs
aufkommen läßt. Der nächste Nachweis stammt erst aus dem Jahr 1637 (Kat.-Nr. 478).
Die Vergrößerung von Anfangsbuchstaben ist erstmals 1539 (Kat.-Nr. 210),
allerdings ungewöhnlicherweise in den Zeilenzwischenraum nach unten, belegt.
Einzelne vergrößerte Anfangsbuchstaben sind in weiterer Folge ab 1551 (Kat.-Nr. 243) zu finden,
häufiger werden die Nachweise ansonsten erst nach 1600.
Zu den Kapitalis-Schriftformen der unten im Abschnitt zur Fraktur näher zu besprechenden
Kremser Werkstatt des Kilian Fuchs vgl. die Schriftbeschreibung bei Kat.-Nr. 414 und die im
folgenden Abschnitt gebotenen Nachzeichnungen.
5.6. Fraktur
Auch die inschriftliche Fraktur erscheint zum Zeitpunkt ihrer ersten Verwendung im Bearbeitungsgebiet
bereits fertig ausgebildet. Den möglicherweise frühesten Beleg stellen die erläuternden
Beischriften zu einer in Sgraffitotechnik ausgeführten Fassadendekoration aus der Mitte des 16.
Jahrhunderts in Langenlois dar (Kat.-Nr. 241). Wiederholte Restaurierungsmaßnahmen haben
den originalen Schriftcharakter beeinträchtigt, doch ermöglichen neben den Einzelformen die
überwiegend spitzovalen Bögen von b und d und einzelne noch feststellbare Schwellzüge trotz
mehrerer stärker gebrochener Buchstaben eine Einordnung der Schrift als Fraktur.
Die erste datierte Frakturinschrift bietet das Epitaph des Wolf Rueber von Pixendorf von 1555
in Grafenegg (Kat.-Nr. 249). Der Einsatz der ausschließlich für deutschsprachige Inschriften verwendeten
Fraktur erfolgte damit um etwa zwei Jahrzehnte nach dem der Kapitalis.
Die Bögen von b, d und o werden auf dem Grafenegger Denkmal entweder spitzoval wiedergegeben
oder an der Oberlinie einfach gebrochen, wobei bei Verbindungsbögen mehrschaftiger
Buchstaben der linke Teil als Anstrich am vorhergehenden Schaft ansetzt. Spitz in den
Unterlängenbereich auslaufende Schwellschäfte sind ebenso wie Schwellzüge deutlich ausgeprägt.
Schaftüberwölbungen in Zeilenzwischenraum wirken ebenso wie die mit Haarzierlinien dekorativ
gestalteten Versalien auflockernd.
Das gesamte Repertoire der frakturtypischen Zierelemente benützt die erhaben geätzte Inschrift
eines nach 1571 entstandenen Epitaphs in Maria Laach a. Jauerling (Kat.-Nr. 282). Freie
obere Schaftenden werden im Zeilenzwischenraum schlingenartig über den Schaft zurückgebogen.
Das spitz zulaufende obere Schaftende des t wird von einem geschwungenen Haarstrich
überschnitten, der mit einer Schaftüberwölbung nach links zurückbiegt. Die Bögen an der Oberlinie
des Mittelbands werden zu dünnen, mit Hornansätzen ausgestatteten Anstrichen samt angesetzten
Schwellzügen umgeformt. Das u trägt weit überwiegend ein geschwungenes diakritisches
Zeichen, ein kommaartiges bzw. aus einem Quadrangel mit zwei kurzen Rechtsschrägstrichen
zusammengesetztes Zeichen bildet den i-Punkt.
Die Umschrift des Epitaphs der Judith von Friedesheim von 1588 (Kat.-Nr. 313) ist in ihrer
zwar abschnittweise unterschiedlich gedrängten, aber insgesamt recht niveauvollen Ausführung
die epigraphische Umsetzung der schreibschriftlichen Fraktur, wie sie als Kanzlei-Auszeichnungsschrift
gegen Ende des Jahrhunderts verwendet wurde. Zwar werden viele Bögen im Mittelband
gebrochen, die senkrechten Teile werden aber nicht schaftartig streng gerade und parallel angeordnet,
sondern bewahren jeweils einen leichten Schwung. Zahlreiche Bögen sind überhaupt
in feine Anstriche an der Oberlinie des Mittelbands und anschließende Schwellzüge aufgelöst.
Feine umgebogene Haarzierlinien, in die die Bögen etwa von g und h im Unterlängenbereich
und zahlreiche Schwellschäfte im Oberlängenbereich auslaufen, verschlungene oder verschnürte
Zierstriche und Überwölbungen von Schäften im Oberlängenbereich und Doppelformen bei a
und g (neben der regulären Form mit moderat durchgebogenem Bogen auch eine Ausprägung
mit durch Schwellzügen optisch eingeschnürtem Bogen) verleihen der Inschrift bewegten und
dekorativen Charakter. Besonders reich sind die Versalien mit Haarlinien ausgestattet, Bogenverbindungen
sind bei den Gemeinen nicht selten.
Gegen Ende des 16. Jahrhunderts zeigen manche Frakturinschriften bereits einen Verlust des
spannungsreichen Schwungs, der den Schrifttyp seit seinem ersten Auftreten ausgezeichnet hatte
(s. Kat.-Nr. 320). Zierelemente wie Hornansätze, Schaftüberwölbungen und „Elefantenrüssel“
bleiben zwar erhalten, doch nimmt das Mittelband unter Aufgabe ausgerundeter Bögen tendenziell
den steifen Gittercharakter der Gotischen Minuskel an. Auch Einzelformen der älteren Minuskelschrift
wie zweistöckiges bzw. Kasten-a dringen nun vereinzelt in weniger niveauvolle Frakturinschriften
ein (s. Kat.-Nr. 336). Selbst qualitativ höherstehende Frakturinschriften weisen starke
Ansätze zur Auflösung aller runden Buchstabenbestandteile in lange, das Mittelband dominierende
parallele Schäfte mit (Pseudo-)Brechungen an der Basislinie auf (s. Kat.-Nr. 344). Vorerst
entziehen sich jedoch ausgezeichnete gemalte und geätzte Frakturinschriften (Kat.-Nr. 359, 371
und 381) noch diesen das Schriftbild im 17. Jahrhundert bestimmenden Entwicklungen.
In den ersten beiden Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts scheint im Bearbeitungsgebiet eine leistungsfähige
Werkstatt existiert zu haben, die überwiegend für Auftraggeber aus dem Adel der Region und das Kloster Göttweig,
aber offenbar auch für wohlhabende Bürger gearbeitet hat. Zu den überwiegend durchaus qualitätvollen Werken dieses
Betriebs zählen alle Formen von Grabdenkmälern in Stein und Holz ebenso wie Altäre, hölzerne Kirchenausstattungen und Bildstöcke.
Eine beachtliche Anzahl an erhaltenen Werken, viele davon im Bearbeitungsgebiet, läßt sich nach
gestalterischen und stilistischen Kriterien bzw. durch eine inschriftenpaläographische Analyse
unterschiedlich eng an einige wenige Werke anschließen, die mit einem konkreten Künstlernamen
verknüpft sind.
Gerald Fischer-Colbrie publizierte 1976 an wenig prominenter Stelle Nachrichten zum Künstler
des Epitaphs der Anna Kirchberger in Maria Laach a. Jauerling (Kat.-Nr. 408)198. Das monumentale
Epitaph, aus unzureichend argumentierten stilistischen Gründen früher oft gemeinsam
mit dem Freigrab Hans Georgs (III.) von Kuefstein (Kat.-Nr. 377) in den Umkreis der Werkstatt
Alexander Colins eingeordnet, stammt nach archivalischen Belegen aus der Werkstatt des Kremser
Bildhauers Kilian Fuchs, der von den Söhnen der Toten, vor allem Hans Ludwig von Kuefstein,
am 5. September 1617 mit der Planung und Ausführung des Denkmals um eine zunächst vereinbarte
Summe von 250 fl. beauftragt wurde. Fertiggestellt war das Epitaph erst am 10. Februar
1619199.
An dieser Stelle ist kein Platz, eine ausführliche Beschreibung der für die Fuchs-Werkstatt
typischen Gestaltungsmerkmale, von Fragen der Gesamtkonzeption und des architektonischen
Aufbaus der Epitaphien und Altäre bis hin zu stilistischen Charakteristika der Figurenzeichnung
und Details der Ornamentik und des Dekors zu bieten. Das Formenrepertoire der Werkstatt war
groß, und zwischen den sehr unterschiedlichen Formgelegenheiten wie monumentalen Grabdenkmälern
und Bildstöcken sind oft nur schwer taugliche Vergleichsmöglichkeiten zu finden. Zudem
zeigen fast alle Arbeiten der Werkstatt auch qualitativ schwächere Teile, sodaß stets von der Beteiligung
mehrerer Hände ausgegangen werden muß. 1617/18 beschäftigte Fuchs nachweislich
mindestens zwei Gesellen, von denen einer, Kaspar Hoffmann, auch namentlich bekannt ist.
Während der kunsthistorischen Bewertung der möglichen Werke Fuchs’ eine eigene Arbeit
gewidmet sein müßte, soll hier nur auf die Inschriften an diesen Objekten eingegangen werden.
Besonders schmerzlich ist in diesem Zusammenhang der Verlust zweier weiterer archivalisch
gesicherter Werke Fuchs’, Kat.-Nr. 415† und 416†. Die Inschrift des Epitaphs der Anna Kirchberger
(Kat.-Nr. 408) hat deshalb bei der Zuschreibung anderer Werke an die Fuchs-Werkstatt,
die neben Fraktur für deutschsprachige regelmäßig Kapitalis für lateinische (und deutschsprachige)
Texte verwendete, größte Bedeutung. Allerdings handelt es sich beim Epitaph der Anna
Kirchberger innerhalb der zu erschließenden Reihe von Arbeiten der Fuchs-Werkstatt, deren
Leiter 1621 starb, um ein spätes Werk. Mit den mutmaßlichen früheren Arbeiten des Betriebs
lassen sich am besten die in relativ konstanter Form eingesetzten Versalien (s. die umseitigen
Nachzeichnungen) vergleichen, während der Gesamteindruck der hier dicht gesetzten und sehr
starr wirkenden Gemeinen vom früher und besonders in den gemalten Inschriften viel bewegteren
Schreiben abweicht.
Erstaunlicherweise zeigt der Kanon der Versalien in hohem Ausmaß Parallelen zu einer zusammengehörigen
Gruppe von drei bzw. vier in Fraktur beschrifteten qualitätvollen Grabdenkmälern der Jahre 1574 und 1578
in Wiener Neustadt200. Ob Fuchs zu der für jene und wohl auch das Epitaph des Kaspar von Hohberg
(Kat.-Nr. 306) verantwortlichen Werkstatt Beziehungen unterhielt, vielleicht sogar seine Ausbildung
in jener erfahren hatte, bleibt freilich völlig unklar.
5.7. Minuskelantiqua
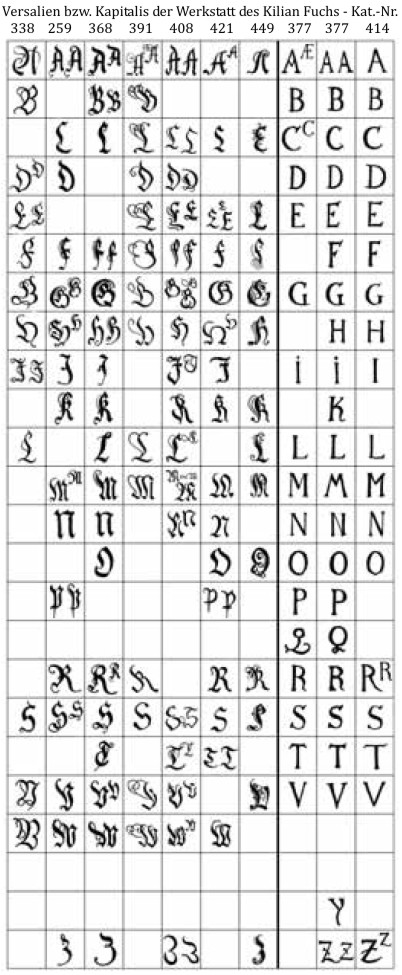
Die Minuskelantiqua (Humanistische Minuskel) besitzt als epigraphische Schriftart,
zumal für längere Texte, im Bestand nur sehr untergeordnete Bedeutung. Gut erhaltene Originale
sind zudem selten, was einen Überblick über die Schriftentwicklung unmöglich macht.
Gewissenhafte kopiale Überlieferung deutet für die lateinische Grabinschrift eines 1541 frühverstorbenen
Kindes aus dem slowakisch-ungarischen Adelsgeschlecht der Thurzó in der Nachzeichnung
glaubwürdig auf eine originale Ausführung in Minuskelantiqua hin (Kat.-Nr. 215†).
Die in Minuskelantiqua gehaltene lateinische Namensbeischrift auf dem fragmentierten Epitaph des
Göttweiger Abtes Michael Herrlich (Kat.-Nr. 304) von 1582 stammt mit größter Wahrscheinlichkeit
erst aus dem 18. Jahrhundert. Die Verwendung dieser Schriftart für erklärende lateinische
Beischriften zu einer verlorenen Bilderserie vom Ende des 16. Jahrhunderts aus Göttweig ist
fraglich (Kat.-Nr. 362†, 363†, 364†).
In sehr spezifischen Anwendungszusammenhängen erscheint Minuskelantiqua innerhalb der
Inschriften auf der Rückseite einer spätmittelalterlichen Johannesschüssel (Kat.-Nr. 401). Die 1612
aufgemalte deutschsprachige Restaurierungsinschrift überliefert den Umstand der Erneuerung
und den Namen der Auftragerin in Fraktur, wobei das ihr beigegebene Attribut uxor im Sinne
einer Auszeichnungsschrift für den fremdsprachigen Einschub in Minuskelantiqua steht. Der
Name des ausführenden Malergesellen ist dagegen vollständig diesem Schrifttyp zuzuordnen. In
„unepigraphischer“ Verwendung steht die Minuskelantiqua auf dem 1616 (?) entstandenen Porträt
des Göttweiger Abtes Georg Falb (Kat.-Nr. 411). Die entsprechenden Vorbildern aus dem zeitgenössischen
Buchdruck nachgeahmte Schrift gibt die lateinische Beschriftung eines Buchvorderdeckels
wieder. Auszeichnungsfunktion für einzelne Wörter des Texts nimmt hier die Kapitalis
wahr.
Die eingravierten durchwegs deutschsprachigen Inschriften einer Sargtafel von 1623 (Kat-Nr. 434)
bevorzugen für die ausführliche Sterbeinschrift eine zeittypische Kapitalis und beschränken
den Einsatz einer schrägliegenden Minuskelantiqua mit starken Anregungen schreibschriftlicher
Cancelleresca auf die gereimte Beischrift einer emblemartig gestalteten Darstellung
sowie auf die Wappenbeischriften der Ahnenprobe. Lediglich die Stellenangabe des Bibelzitats auf
einer verlorenen Sargtafel von 1618 (Kat.-Nr. 421a†) dürfte in einer sehr ähnlichen schrägliegenden
Minuskelantiqua ausgeführt gewesen sein.
Die kurze Namensinschrift (?) auf einem Totenschild von 1628 in Maria Laach a. Jauerling
(Kat.-Nr. 449) erlaubt keine zeitliche Einordnung.
Ein Gemälde mit der Ansicht der Klosters Göttweig unter dem Schutz der Gottesmutter, 1630
Abt Georg Falb als Geburtstagsgeschenk überreicht (Kat.-Nr.459), setzte Minuskelantiqua innerhalb
der in Kapitalis umgesetzten lateinischen Inschrift neben einzelnen eher zufällig in Minuskel
ausgeführten ganzen Wörtern offenbar regelmäßig für die verkleinert hochgestellten Kasusendungen
abgekürzter Wörter ein. Da die originale Beschriftung des Gemäldes heute durch
Restaurierungsmaßnahmen verfälscht und teilweise entstellt ist, muß sich der geschilderte Befund
auf die Nachzeichnung allerdings äußerst sorgfältiger kopialer Überlieferung des 18. Jahrhunderts
stützen.
Das von derselben Quelle tradierte Göttweiger Gemälde mit der Nachricht eines ungewöhnlichen
Fischfangs aus dem Jahr 1647 (Kat.-Nr. 505†) brachte den eigentlichen Informationsgehalt
in mehreren Kapitalis-Zeilen unter und schloß einen einzeiligen Gebetsspruch in schrägliegender
Minuskelantiqua an.
Unter restauratorischen Eingriffen in die ursprüngliche Substanz leidet die lateinische Inschrift
eines Votivbilds in Maria Langegg, das der Lilienfelder Abt Cornelius Strauch testamentarisch
1650 verfügt hatte (Kat.-Nr. 511). Neben einer einzelnen Zeile in Kapitalis stehen ein versifiziertes
Chronogramm oder Chronodistichon, das auf die bildliche Darstellung Bezug nimmt, und
die eigentliche Votivinschrift in Minuskelantiqua. Die Zahlzeichen des Chronogramms und zwei
Wörter mit Auszeichungsfunktion sind in Kapitalis ausgeführt.
Die Aufgabe einer Auszeichnungsschrift erfüllt eine überwiegend leicht schrägliegende
Minuskelantiqua für die Inschriften eines umfangreichen religös-didaktischen typologischen Bildprogramms
im Chor der Spitzer Pfarrkirche aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts (Kat.-Nr. 514).
In Minuskelantiqua sind die Stellenangaben zu den bildlich dargestellten Bibeltexten
sowohl innerhalb der deutschsprachigen Frakturinschriften als auch der lateinischen Texte (in
Kapitalis) abgefaßt.
5.8. Mischschriften und nicht-epigraphische (schreibschriftliche) Schriftarten
Zu den wenigen Majuskelmischschriften des Bestands vgl. die Anmerkungen bzw. Verweise
unter Abschnitt 5.3. Für den Nachweis der unterschiedlichen schreibschriftlichen Alphabeten,
etwa spätgotischen Kursiven unterschiedlichen Stilisierungsgrads, entstammenden Formen einzelner
Minuskelmischschriften bzw. die Verwendung von nicht-epigraphischen Schreibschriften
vgl. die jeweiligen Stellen im Katalog (Kat.-Nr. 71, 81, 185†, 187, 188, 190, 231, 237, 254,
340).
Andreas Zajic
Die Deutschen Inschriften
Herausgegeben von den Akademien der Wissenschaften in
Düsseldorf · Göttingen · Heidelberg · Leipzig · Mainz · München
und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien
72. Band, Wiener Reihe 3. Band
Die Inschriften des Bundeslandes Niederösterreich - Teil 3
Die Inschriften des Politischen Bezirks Krems
 Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
Austrian Academy of Sciences Press
|
|
Schlagworte
Die Inschriften des Bundeslandes Niederösterreich • Politischer Bezirk Krems • Die Schriftformen • Romanische und Gotische Majuskel (vgl die abgebildeten Nachzeichnungen) • Gotische Minuskel (vgl die abgebildeten Nachzeichnungen) • Frühhumanistische Kapitalis und von ihr abgeleitete Majuskelmischschriften (vgl die abgebildeten Nachzeichnungen) • Gotico-Antiqua (vgl die abgebildeten Nachzeichnungen) • Kapitalis • Fraktur • Minuskelantiqua • Mischschriften und nicht-epigraphische (schreibschriftliche) Schriftarten • Andreas Zajic •
Abbildungen
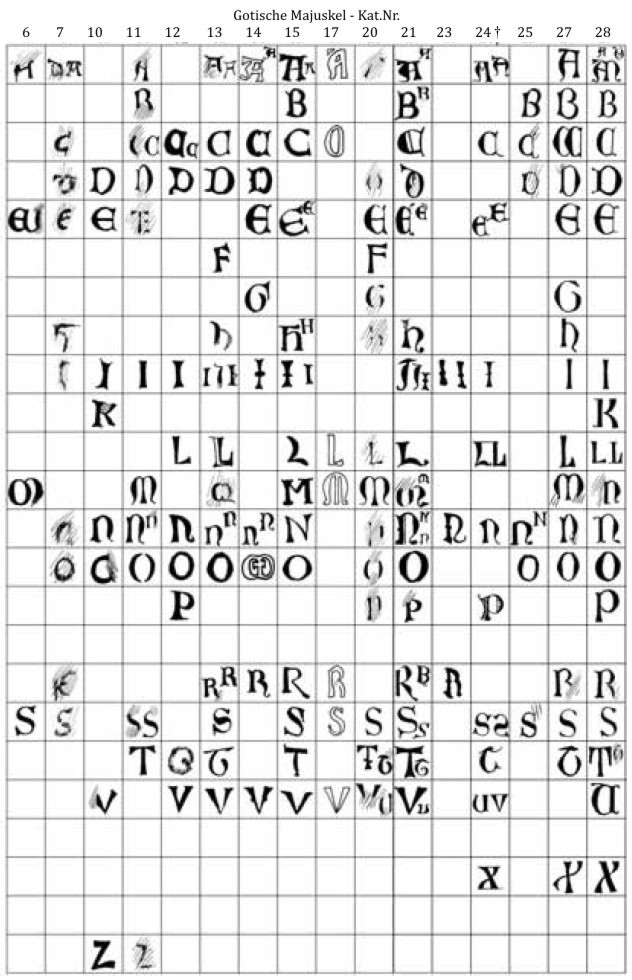
Gotische Majuskel - Kat.-Nr.
6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 24†, 25, 27, 28
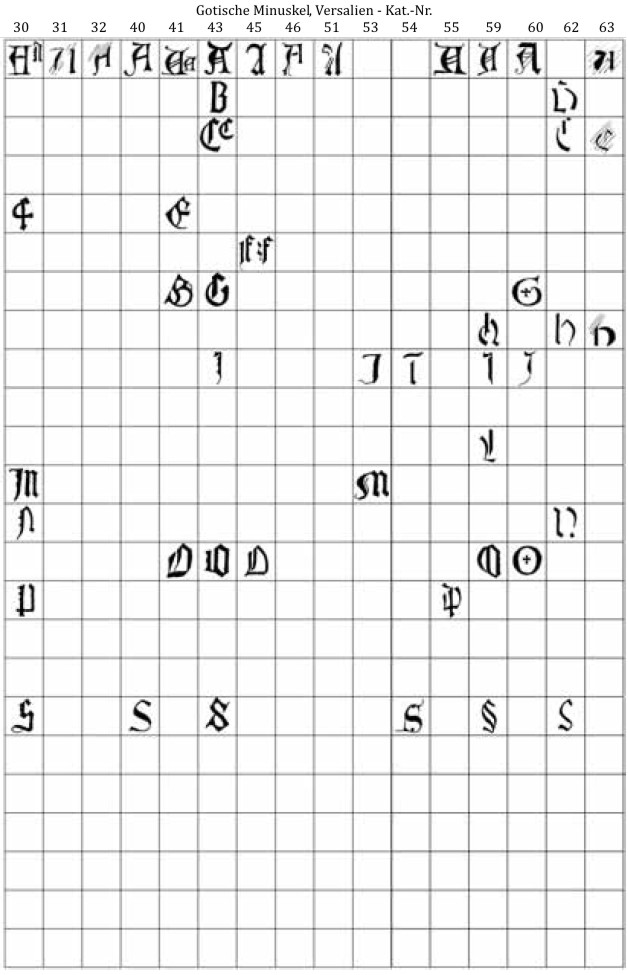
Gotische Minuskel, Versalien
Kat.-Nr. 30, 31, 32, 40, 41, 43, 45, 46, 51, 53, 54, 55, 59, 60, 62, 63

Gotische Minuskel, Versalien
Kat.-Nr. 64, 65, 67, 71, 73, 74, 82, 83, 94, 97, 99, 102, 105, 111, 130, 138

Gotische Minuskel, Versalien
Kat.-Nr. 141, 145, 149, 171, 172, 176, 177, 186, 199, 200, 204, 256, 303
|


Die Inschriften des Politischen Bezirks Krems, ges. u. bearb. v. Andreas Zajic
(Die Deutschen Inschriften 72. Band, Wiener Reihe 3. Band, Teil 3) Wien 2008, 5. Die Schriftformen,
URL: hw.oeaw.ac.at/inschriften/noe-3/noe-3-schrift.xml